





Text von Heide Wilts
Mittags verlassen wir die Lagune durch den Westeingang, und im Laufe des Nachmittags dreht der Wind einen Vollkreis: Südost-Ost-Nordost-Nord-Nordwest-Süd. Willkommen auf dem Indik!
Zwei Tage und Nächte sind wir schon wieder unterwegs bei stark wechselnden Winden – mal zu viel, mal aus der falschen Richtung, dann wieder Flaute, und immer die hohe südliche Dünung. Im Pazifik könnte ich El Niño oder La Niña die Schuld geben, doch hier ist es einfach nur der ganz normale Wahnsinn.
5. Juli: Abwechslung bringt eine klare Nacht mit Vollmond, in dessen Licht man lesen kann! Nach einer Stunde hat er sich in einen Halbmond und nach ein paar weiteren Minuten in eine Mondsichel verwandelt. „Das muss eine Mondfinsternis sein“, kombiniert Erich messerscharf. Nach einer Stunde ist der Spuk vorbei und der Vollmond prangt wieder am Himmel, als ginge ihn das alles nichts an.
Seitdem sind schon wieder drei Tage vergangen. Der Südostwind hat auf acht bis neun Beaufort aufgefrischt. Bange Frage: Bleibt er so stark, wohin dreht er? Zwei Reffs im Großsegel und das Vorsegel auf Handtuchgröße eingedreht, kämpft sich die „Freydis“ mit sechs bis acht Knoten durch eine chaotisch schäumende See. Verantwortlich dafür ist neben dem Wind auch der Neunzig-Grad-Ost-Rücken, ein inaktiver vulkanischer Unterwasser-Gebirgszug, der entlang des neunzigsten östlichen Längengrads verläuft und von knapp 6.000 Metern Tiefe steil auf 2.000 bis 1.000 Meter ansteigt und für Verwirbelungen sorgt. Eine Zone, die uns einiges abverlangt, zumal der Wind nun wieder vorlicher bläst und ständig Brecher ins Cockpit steigen.
Nach ein paar Stunden ist im Schiff alles feucht, klamm und ungemütlich. Wir sind beide unterschwellig seekrank und haben uns in den Salon gelegt – immer auf dem Sprung, ins Cockpit zu hechten und per Hand zu steuern, falls die automatische Selbststeueranlage das Boot nicht mehr auf Kurs halten kann. Bewundernswert, was sie leistet! Ich bete, dass sie durchhält!
Wird das vielleicht mein Ende sein?
Der Ozean trifft uns nun mit voller Wucht, und der Wind singt sein Hexenlied in der Takelage. Dabei kommt mir ein Zitat von Robert Louis Stevenson in den Sinn: „Ich habe stets das Geräusch des Windes mehr als alles andere gefürchtet. In meiner Hölle würde immer ein Sturm blasen.“
Was für eine scheußliche Nacht! An Bord ist die Unvorhersehbarkeit der Welt im Zeitraffer zu erleben. Die harten Schläge und das Stolpern des Schiffes erschrecken mich. Dosen und Flaschen in den Proviantschapps werden mit dumpfem Gepolter hin und her geschoben, hin und her … Wir versuchen trotz des Lärms zu entspannen, vielleicht sogar ein wenig Schlaf nachzuholen, um bei Kräften zu bleiben. Ich merke, wie meine Gedanken dabei langsam weggleiten – nach Hause zu meiner Familie, meinen Freunden, anderen Orten, Sorgen, Wünschen, Sehnsüchten und hinüber in einen unruhigen Schlaf. Wird das vielleicht mein Ende sein?
Aufruhr der Elemente! Das Gewürzregal über dem Herd ist runtergekracht. Mit einem Mal bin ich wieder hellwach: 30 kleine Flaschen und Dosen kullern auf dem Boden herum. Es riecht nach Vanille und der Inhalt mischt sich mit dem Oregano, der gekörnten Hühnerbrühe und dem Sesamöl aus anderen Behältnissen. Eine ganze Rolle Klopapier benötige ich, um das klebrige „Chutney“ von den Bodenbrettern zu wischen, wobei das meiste ohnehin in der Bilge gelandet ist. Nach der Putzaktion bin ich endgültig seekrank und schachmatt. Erich schaut nach den Segeln, dem Kurs. „Alles o.k.!“, brummt er beruhigend.
Einmal über den Südindik reicht – nun machen wir es erneut
Wie Gespenster aus der See steigen während meiner Wache Erinnerungsfetzen aus früheren Segelreisen durch den Indik in mir auf – zu den Komoren, den Îles Éparses, nach Aldabra und Madagaskar, zu den Prinz Edwards, Crozets, Heard, Kerguelen und St. Paul –, an den schweren Sturm in der Crozet-Bucht mit Szenen, die um Haaresbreite schiefgegangen wären, an den Knock-down auf dem Wege von Heard nach St. Paul, der ein Schock für die ganze Mannschaft war; schlagartig war uns dadurch unsere Verwundbarkeit bewusst geworden und wie ernst unsere Lage in den unglaublich hohen, mörderischen Seen war. Wochen später, bei unserer Ankunft in Fremantle/Australien, hatte ich aus tiefstem Herzen gerufen: „Einmal über den Südindik ist genug!“, nachdem uns dieses Meer in den stürmischen Vierzigern und Fünfzigern wahrhaftig nichts geschenkt hatte.
Und nun, als wäre das nicht genug, durchqueren wir ihn noch einmal – zwar in entgegengesetzter Richtung und in Äquatornähe, doch auch hier zeigt er uns sein „Herz der Finsternis“: ständig hohe Dünung aus Süd, ständig wechselnde Winde in Stärke und Richtung, die ständig Manöver fordern – ein- und ausreffen, schiften, ausbaumen.
Zu guter Seemannschaft gehört das Voraussehen bestimmter Situationen, das frühzeitige Darauf-Einstellen und damit das Vermeiden unnötiger Risiken. Kaum etwas ist schlimmer, als in bestimmten Situationen davon auszugehen, dass „es schon gut gehen“ wird.
Ein wildes Tier im Sturm
Schlafen ist kaum möglich, man rollt hin und her, auch wenn man noch so viele Kissen um sich herumstopft. Und am Tag sind alle Sinne gefordert, jede Bewegung muss überlegt werden: Falltürartig entziehen sich Böden und Treppen dem Tritt oder stemmen sich ihm entgegen, und der Esstisch im Cockpit kippt dem Hungrigen, ehe er sich’s versieht, Teller samt Mahlzeit auf den Schoß. Kein Wunder, dass Verstand, Magen und Wirbelsäule rebellieren.
Das Boot verhält sich wie ein wildes Tier, dessen Reaktionen man nicht durchschaut. Trotz aller Erfahrung und einem sechsten Sinn, den man mit der Zeit für seine Eigenheiten entwickelt hat, muss man ständig auf der Hut sein. Man kann das Boot zwar auf einen bestimmten Kurs bringen, aber sonst sind die Möglichkeiten begrenzt: Man torkelt, hangelt sich ungelenk und tapsig wie ein Betrunkener vorwärts, und einfache Handgriffe werden zur Schwerarbeit.
Die Erkenntnis, dass das Festhalten an Dingen keine Sicherheit vermitteln kann, ist an Bord ganz praktisch zu erfahren. Hier ist nichts sicher, nichts fest, auf nichts Verlass. Am Leben zu bleiben ist alles. Daran habe ich mich gewöhnt, ein risikofreies Leben gibt es nicht. Auf Rodrigues werde ich umfallen.
Aber ich kann Joshua Slocum verstehen, wenn er schreibt: „Doch wo wäre schließlich der Zauber der See, wenn es auf ihr keine wilden Wellen gäbe?“ Für mich ist das Meer ein letztes Stück unverfälschter Natur mit eigenen Gesetzen und Antreibern – Wind, Strom, Gezeiten. Es atmet Kraft, Freiheit, Ewigkeit, lässt sich nicht erobern, nicht kontrollieren, nicht bändigen.
Ruhe nach dem Sturm
Am Morgen flaut der Sturm ab. Gegen Mittag noch Wasserberge, aber ohne Schaumkronen, ohne Biss. Der Barograf hat während des Sturms nur seine üblichen Tropenkurven gekritzelt. „Wir ersaufen hier und dieser Experte zeigt nicht mal den kleinsten Zacken!“, rufe ich empört. Erich am Navi-Gerät ist dagegen begeistert: „Seit gestern Mittag haben wir 151 Seemeilen geschafft, und das bei vorlichem Wind, das ist der Rekord der bisherigen Reise!“
11. Juli, 20 Uhr: Bis Rodrigues sind es noch 1.000 Seemeilen, also etwa neun Tage. Wir feiern „Bergfest“ mit Pizza und Rotwein, denn damit ist der „Gipfel“ erreicht, nun läuft der Countdown nach Rodrigues, der kleinsten Insel der Maskarenen-Gruppe. Ich will endlich „Voyage à Rodrigues“ von Jean-Marie Le Clézio lesen.
Am schwarzblauen Himmel glitzern Sterne, das Kreuz des Südens scheint uns zu winken. In unserem Kielwasser schwimmen zwei große Glattwale. So etwas haben wir schon einmal im Pazifik erlebt. Sie halten konstant zwei Schiffslängen Abstand, obwohl wir immerhin sieben Knoten Fahrt machen! Halten sie uns für ihre Leitkuh? Oder sind wir Pacemaker für sie? Auf Erichs Nachtwache verschwinden sie irgendwann.
Kein Schiff, kein Flugzeug weit und breit, kaum Seevögel. Oft landen nachts fliegende Fische an Deck, die wir erst am Morgen finden. Zum Frühstück, wie früher auf dem Atlantik, will keiner sie essen. Ich vermisse unsere Bordkatzen, Robbi und Adelie; sie würden die Fische zu schätzen wissen!
„Freydis“ wittert schon den Hafen
12. Juli: „Ich kapier nicht, wo der Passat bleibt“, wundert sich Erich. „Es scheint, als hätten wir seine Südgrenze überschritten.“ Tatsächlich wurden wir durch die häufigen Winddrehungen nach Süden abgedrängt.
Wir nehmen uns fest vor, das Boot wieder auf Kurs zu bringen und diesen Fehler künftig zu vermeiden, indem wir bei Winddrehungen und Böen rasch die Segelstellung anpassen. Ein harter Job, denn der Wachgänger steht bei dem wechselhaften Wetter ständig unter Anspannung und muss notfalls auch den Partner wecken. Seit Tagen schlafen wir nie mehr als zwei Stunden am Stück.
19. Juli: Das Gegensteuern hat sich gelohnt: Wir sind wieder auf direktem Kurs nach Rodrigues. Die Maskarenen waren bereits auf mittelalterlichen Seekarten der Araber eingezeichnet, auf deren Handelsrouten von Ostafrika und Madagaskar zur Arabischen Halbinsel nach Indien und Indonesien sie lagen. Ihre europäischen Namen erhielten sie später von den Portugiesen, nachdem Bartolomeu Dias 1486 den Seeweg ums Kap der Guten Hoffnung und Vasco da Gama 1498 den Weg nach Indien gefunden hatten. Denn auch die portugiesischen Handelsschiffe suchten die Inseln auf, um sich mit Frischfleisch und Früchten zu verproviantieren. Später kamen die Schiffe der Walfänger, der Piraten und der Niederländischen Ostindien-Kompanie. Und nun sind wir neugierig, was aus den Inseln geworden ist. Detailkarten liegen auf dem Tisch.
Die „Freydis“ wittert schon den Hafen und hat es eilig: Trotz verkleinerter Segel jagt sie in gestrecktem Galopp über die aufgewühlte See. Beidrehen geht nicht, die Genua ganz wegnehmen auch nicht: Mit den Brechern ist die See dafür viel zu rau. Besser, wir laufen rasch unter Landschutz und warten, bis es hell wird.
Um zwei Uhr nachts haben wir Rodrigues in 14 Seemeilen Entfernung auf dem Radar. Etwas später sind ihre Lichter mit bloßem Auge zu erkennen, verschwinden aber immer wieder hinter schweren Regenböen. Um vier Uhr früh drehen wir in Lee der Insel bei.
Das Buch: “Lichter am Horizont” von Heide Wilts
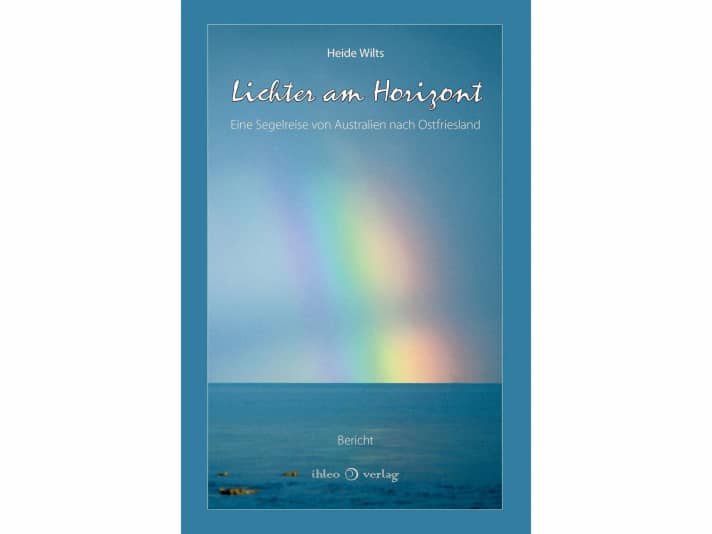
Mit ihrem aktuellen Buch vervollständigt Heide Wilts die Reihe über alle von 1969 bis 2021 mit ihrem 2022 verstorbenen Ehemann Erich gesegelten Reisen zu den abgelegensten Winkeln der Erde. Mehr als 350.000 Seemeilen ließen die Wilts dabei im Kielwasser. Ihleo Verlag, 25 Euro.

