America’s Cup: Erstmals sichtbarer Wind – wie WindSight IQ das Segeln revolutioniert
Max Gasser
· 18.10.2024



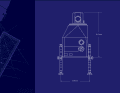


- LiDAR: So funktioniert Windsight IQ beim America’s Cup
- 1,5 Millionen Messpunkte durch drei Laser
- So kommt die Windvisualisierung beim America’s Cup ins TV-Bild
- Windsight IQ ermittelt den optimalen Kurs
- Hat die Capgemini-Technologie eine Zukunft im Fahrtensegeln?
- Weltweites Windsight-IQ-Netz und Segelentwicklung mit LiDARs
Warum setzt Ineos-Britannia-Skipper Ben Ainslie nicht zur Wende an, um die Neuseeländer eng zu decken oder weshalb fährt ein Team trotz Windschatten erstmal weiter? Diese oder ähnliche Fragen hätte man sich in den vergangenen Tagen des Öfteren stellen können. Wäre da nicht Windsight IQ. Nicht selten lieferte die neueste Errungenschaft der TV-Übertragungstechnik im Segelsport eine aufschlussreiche Antwort. Durch Einfärbungen des Wassers wie bei einer Wärmebildkamera werden Windfelder live auf dem Rennkurs visualisiert. Erstmals gewährt das allen Zuschauern einen Einblick in die strategischen Überlegungen der Athleten auf dem Wasser.
„Die Möglichkeit, den unsichtbaren Wind zu sehen und die tatsächlichen Leistungen und taktischen Entscheidungen der Teams mit den optimalen Routen zu vergleichen, bedeutet, dass die Zuschauer das Rennen auf einer ganz neuen Ebene verfolgen und sich daran beteiligen können“, sagt Grant Dalton, CEO des America’s Cup Events.
Aufgrund der technischen Herausforderung war zuvor niemand in der Lage gewesen, die Bedingungen bei einer Regatta in Echtzeit darzustellen. Das globale Tech-Unternehmen Capgemini erarbeitete gemeinsam mit Broadcaster America’s Cup Media jedoch die bahnbrechende Lösung. „Wir wollten Segeln einer breiteren Masse einfacher und schneller vermitteln und dabei keine Vorhersagen machen, sondern den tatsächlichen Wind zeigen“, so Gerrit Bottemöller. Der Braunschweiger war beim 32. America’s Cup 2007 selbst als Mastmann an Bord beim United Internet Team Germany und ist ein wichtiger Experte im Windsight-IQ-Team bei Capgemini.
LiDAR: So funktioniert Windsight IQ beim America’s Cup
Grundlegend beruht das System auf dem dreidimensionalen Laserscanning der LiDAR-Technologie (Light Detection and Ranging), die unter anderem auch in der Topographie und Automobilindustrie von großer Bedeutung ist. Statt der Radiowellen wie beim Radar werden genauere und schnellere Laserstrahlen verwendet, um Partikel in der Luft zu messen. Zur Erfassung der Wind-Rohdaten wurden daher drei LiDARs entlang der Uferpromenade von Barcelona mit Blick auf den Rennkurs installiert. „Die scannen versetzt die Bucht. Wir machen das aktuell in einem fünf auf sechs Kilometer großen Feld. Wir könnten dieses bis auf zwölf Kilometer ausdehnen“, erklärt Bottemöller.
Die mit je 250.000 Euro bezifferten Laser-Messeinheiten können Windgeschwindigkeiten und -richtungen bis zu 68 Knoten mit einer Genauigkeit von weniger als 0,1 Meter pro Sekunde Abweichung erfassen. Mit diesen Daten wird die Übertragung sekündlich aktualisiert gespeist. Messungen von den Booten und den Tonnen ergänzen das durch Algorithmen zusammengeführte Datenpaket und ermöglichen die Echtzeit-Darstellung für die Fernseh-Zuschauer. Die Genauigkeit des Systems ist dabei überwältigend.
1,5 Millionen Messpunkte durch drei Laser
Allein die drei überlappend angeordneten LiDARs ermöglichen ein Raster von 1,5 Millionen Messpunkten. Cup-Veteran Bottemöller verdeutlicht: „Um nur annähernd daran zu kommen, bräuchte es 200.000 Bojen auf diesem Feld. Das ist nicht finanzierbar und da kann ja auch keiner mehr segeln.“ Dass mittlerweile auch die Wettfahrtleitung Windsight IQ in ihre Überlegungen einbezieht, war der Ritterschlag für die junge Technologie.
Um auch die Fans des America’s Cup durch Windsight IQ stets mit derart verlässlichen Daten zu versorgen, müssen die Laser immer an die aktuellen Bedingungen angepasst werden. „Laser funktionieren durch den Dopplereffekt, also durch Reflektion. Wenn wir eine hohe Pollution haben, dann haben wir ein ganz gutes Bild. Wenn jetzt aber Regen kommt, dann müssen wir den Regen ausfiltern, das können wir alles. Das ist kein Problem. Aber nach dem Regen ist die Luft klarer. Auch das müssen wir nachjustieren“, so Gerrit Bottemöller. Über sechs Monate habe man dafür bei unterschiedlichsten Gegebenheiten experimentiert und Daten gesammelt. In der Live-Operation justieren und kalibrieren mehrere Ingenieure die Laser-Messwerte mit.
So kommt die Windvisualisierung beim America’s Cup ins TV-Bild
Auch bei der Darstellung im TV-Bild gibt es zahlreiche Herausforderungen. Zunächst muss der unglaubliche Datenfluss mithilfe verschiedener Algorithmen vereinfacht und so flüssig visualisiert werden. Das geschieht nach einem simplen Prinzip: Alles, was oberhalb und unterhalb der aktuellen durchschnittlichen Windgeschwindigkeit liegt, wird eingefärbt. Mit Pfeilen wird zudem die genaue Windrichtung angezeigt. Insbesondere die Augmented-Reality-Grafiken – also die in ein reales Bild integrierten interaktiven Elemente – müssen wie die Messstationen an die Witterung angepasst werden, betont Bottemöller: „Bei Bedeckung oder Sonne sieht das Meer anders aus und es muss einfach verständlich sein, es darf keine große Erklärung brauchen.“
Nur so kann jedermann tatsächlich nachvollziehen, was die Segel-Asse auf dem Kurs versuchen. „Die Zuschauer sehen das, was die Segler nicht sehen. Und das stellt die Fähigkeiten der Segler nochmal weiter heraus. Wenn sie die Windspots und Dreher richtig interpretieren, wird das Können überhaupt sichtbar“, so Bottemöller. Und während an Bord auf keinerlei derartige Systeme zurückgegriffen werden kann, gibt es für die Konsumenten ein weiteres spannendes Feature: das sogenannte Ghostboat.
Windsight IQ ermittelt den optimalen Kurs
Dieses trifft eine Vorhersage über den optimalen Kurs auf dem nächsten Bahnschenkel und simuliert diesen. Die Software macht also eine Art Wetter-Routing, wie man es aus dem Offshore-Bereich kennt, allerdings für den stets zwischen ungefähr einer und zwei Seemeilen langen America’s-Cup-Kurs. Entscheidend dabei: „Wenn wir eine Vorhersage für das gelbe oder blaue Boot machen, dann liegen dahinter wirklich die aktuellen Performance-Daten des jeweiligen Bootes.“ Man greife auf den kompletten Datensatz, der dem Broadcasting-Team zur Verfügung steht, zu, so Bottemöller. Noch präziser wäre der tatsächliche digitale Zwilling der Cupper, diesen wolle jedoch keines der Teams herausrücken.
In der Übertragung wird die Funktion nicht nur vor dem Start, sondern häufig auch dann eingesetzt, wenn sich die Teams beispielsweise für einen Split am Luv-Tor entscheiden. Dank des simulierten „Geisterbootes“ kann dann prognostiziert werden, wer bei der nächsten Begegnung in Führung liegt.
Auch Windverwirblungen und Abdeckungen könnten mit Windsight IQ visualisiert werden, aktuell wird das jedoch nicht praktiziert. Ex-Segelprofi und Ingenieur Bottemöller verrät: „Wir haben noch extrem viele andere Ideen gehabt, aber wir wollten es auch nicht zu überfrachten.“ Tatsächlich aber sind nicht nur Windschatten der AC75, den Zuschauerbooten oder gar großen Gebäuden an Land in den Daten ersichtlich, sondern auch der sogenannte Downwash der Helikopter.
Hat die Capgemini-Technologie eine Zukunft im Fahrtensegeln?
Das Capgemini-System kann variabel eingestellt werden, aktuell hat man sich auf eine Bereich von 18 bis 26 Meter über Null geeinigt, in der die für die Umgebung gänzlich ungefährlichen Eye-Safe-Laser verbaut sind. Bei einer Masthöhe von 26 Metern bei den aktuellen America’s-Cup-Booten kann der entscheidende Bereich damit ebenfalls problemlos abgebildet werden.
Auch manch einen Fahrtensegler dürfte diese Tatsache auf den Plan rufen: Was, wenn wir bald alle einen LiDAR im Mast haben und nur noch mit VR-Brillen segeln, um stets den eigentlich unsichtbaren Wind vor Augen zu haben? Wohl eher nicht. Abgesehen von der unter anderem aufgrund der Bewegung des Schiffes erschwerten Umsetzung, ist kaum ein Fahrtensegler auf eine derartige Visualisierung der Bedingungen unmittelbar um ihn herum angewiesen. Eine solche Technologie dürfte einzig und allein Segelschulen ansprechen, wobei auch hier die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen wäre. Auch auf Regatten könnte das System mit entscheidenden Nuancen Vorteile verschaffen, würde womöglich aber schnellstmöglich in jeglichen Klassenvorschriften verboten werden.
Weltweites Windsight-IQ-Netz und Segelentwicklung mit LiDARs
Experte Gerrit Bottemöller erwartet eine solche Entwicklung ohnehin nicht in den nächsten Jahren, hat dafür aber einen anderen Ansatz für das Fahrtensegeln: „Ich sehe eher ein Netz von fest installierten LiDARs an neuralgischen Punkten oder Hafeneinfahrten und dergleichen.“ Auf diese könnte man dann beispielsweise über eine App zugreifen und sich vor und beim Befahren einer schwierigen Passage mit den Live-Daten versorgen. Gerade für Einsteiger und Chartersegler in fremden Revieren könnte das auch aus Sicherheitsaspekten ein großer Vorteil sein. Auch mit LiDARs ausgerüstete Drohnen, die vorausgeschickt werden, könnten eine Rolle spielen. Dieses Konzept soll vor allem in der Segel-unterstützten Berufsschifffahrt Anwendung finden.
Für den Otto Normalsegler könnte die Laser-Technologie in einem weiteren Bereich interessant werden: beim Segel(-trimm). Das Emirates Team New Zealand hat es beim Training vor dem finalen America’s Cup Match vorgemacht und je einen Laser an Backbord und Steuerbord installiert. Gescannt wurden allen Vermutungen nach sowohl die Segel als auch die Wasseroberfläche. Die Analyse erfolgt dann mit den Performance-Daten des Bootes. Diese Vorgehensweise könnte auch in der Segelentwicklung für den allgemeinen Markt oder der Trimmoptimierung eingesetzt werden.
Die aktuell dafür bestehenden finanziellen Hürden könne man überwinden, so Bottemöller. „Ich glaube, dass wir die Technologie, wenn wir mehr Anwendungsfelder haben, einfach günstiger machen können. Ich bin fest davon überzeugt.“ Am Ende des Cups werde man ungefähr 15 bis 17 Terabyte Daten gesammelt haben, mit denen man die Innovation weiter vorantreiben könne. Dazu kommen weitere Aufgabenfelder außerhalb des Segelns. Denn die im America’s Cup entwickelten Systeme könnten auch andere Sportarten wie Golfen, Football und die Formel 1 entscheidend vorantreiben oder einen Quantensprung an Flughäfen oder bei der Waldbrand-Prävention darstellen.

