




- “Maranatha” soll eine Art Oldtimeryacht mit Rahtakelung werden
- Jahrelang dient bei Grebes alles nur dem einen Zweck
- Brigantine wird zur Pilgerstätte
- „Maranatha“ ist aramäisch und bedeutet „Unser Herr kommt!“
- Ein zweites Leben als Motorschiff auf dem Mittelmeer
- Planung und Bau
- Stapellauf und Reise
- Technische Daten der “Maranatha”
Die Hansestadt Lübeck hat viele Wahrzeichen. Doch trotz Berühmtheiten wie Holstentor, Buddenbrookhaus und „Passat“ – es gab eine Zeit, da kam Seglern, als sie an „Lübeck“ dachten, weder die großen Sehenswürdigkeiten noch das Marzipan als Erstes in den Sinn, sondern die „Maranatha“, eine urige Brigantine aus massivem Tropenholz, deren Silhouette an Hansekoggen und Piratenschiffe erinnert und die sich gut in das barocke Stadtbild einfügte, vor dem sie ihren Liegeplatz hatte.
Die Konstruktion des in sechs Jahren von einem Vater mit seinen drei Söhnen ohne professionelle Hilfe gebauten Schiffes folgt keinem Vorbild. Die „Maranatha“ wurde ausschließlich den Bedürfnissen der Familie angepasst, die darauf während einer mehrjährigen Weltumsegelung leben wollte. So geriet das Schiff zum schwimmenden Superlativ. Schon die Abmessungen – 27 Meter lang der Rumpf, 120 Tonnen schwer das von 600 Quadratmetern Segeln angetriebene Gesamtergebnis – sprengen alle Grenzen dessen, was unter Selbstbauern üblich ist. Der Aufwand von 40.000 Arbeitsstunden und geschätzt 1,5 Millionen Mark Materialkosten sind für Schiffe aus Eigenarbeit unvorstellbare Größen. Dass die „Maranatha“ 1991 trotzdem fertig wurde und zur geplanten Reise auslief, ist nur dem ungebremsten Elan ihrer leidensfähigen Erbauer zu verdanken.
Auch interessant:
Zuletzt lag die „Maranatha“ in einem Nebenarm der Trave am Rande der Lübecker Altstadt. Der Eigner, um ihren Verkauf bemüht, führte regelmäßig Besucher durchs Boot. „Es ist fast wie zu Hause“, sagt Henrik Arnold dann, der das Schiff von seinem Vater, dem zweiten Eigner, geerbt hat. „135 Quadratmeter Wohnfläche, sieben Zimmer, Öl-Zentralheizung, Einbauküche mit Geschirrspülmaschine, Bäder, Waschmaschine.“
Recht hat er. Wer das „Eigenheim auf See“ (YACHT 24/1992) durch die gewaltigen Schotten im Deckshaus betritt, den empfängt eine Einrichtung, die eher an das Innere eines Reihenhauses aus den 1980er-Jahren als an die Kajüte einer Segelyacht erinnert. Das monströse Deckshaus beherbergt die offene Kombüse an Steuerbord, gegenüber die Back mit Platz für zehn Personen auf einer Rundsitzgruppe, davor auf jeder Seite ein Steuerstand. Auf dem Kartentisch liegt noch das aufgeschlagene Logbuch, mit der letzten Eintragung aus dem Jahr 2005. Seither wurden mit der „Maranatha“ keine längeren Seereisen mehr unternommen.
“Maranatha” soll eine Art Oldtimeryacht mit Rahtakelung werden
Selbst die Interessenten, denen Arnold schon seit Jahren das Schiff zeigt, dachten meist eher an eine Verwendung als Wohnboot, Filmkulisse, schwimmendes Restaurant oder Hotelschiff. Dass die Brigantine einst den Atlantik in beide Richtungen überquerte, dabei Etmale von mehr als 170 Seemeilen loggte und später vordere Plätze auf Großsegler-Regatten einfuhr, interessierte zuletzt niemanden mehr. Der extravagante Lebensraum an und unter Deck hingegen schon, und der hebt die „Maranatha“ tatsächlich bis heute von ihresgleichen ab. Doch was heißt eigentlich „ihresgleichen“?
„Solch einen Schiffstyp gab es vorher nirgends“, stellt der Konstrukteur und Bauherr der „Maranatha“, Udo Grebe, in dem Buch „Abenteuer zwischen Traum und Wirklichkeit“ fest. „Eine Art Oldtimeryacht mit Rahtakelung“ wollte er schaffen, ein „reines Fantasieprodukt“.
Der Ingenieur lässt sich Anfang der siebziger Jahre mit seiner Frau und den drei Söhnen an der Lübecker Bucht nieder. Sie verbringen ihre Freizeit auf dem Wasser. Ein umgebauter 30er-Jollenkreuzer dient als Untersatz, Reisebeschreibungen als Nachtlektüre. Es ist die Zeit, in der eine Weltumsegelung mit Familie salonfähig wird. Und so entsteht auch Grebes Traum von einer solchen Reise – und vom geeigneten Schiff dafür.
„Es sollte eine echte Weltreise werden, mit der ganzen Familie, über mehrere Jahre, in denen wir Land und Leute kennenlernen wollten“, erinnert sich Grebes Sohn Marius. „Doch weder neu noch gebraucht gab es bezahlbare Schiffe am Markt, die unseren Vorstellungen entsprachen.“ Als der Vater sich schließlich an den Zeichentisch stellt und eigene Entwürfe anfertigt, leistet der älteste Filius ihm mit großem Interesse Gesellschaft.
„Ich war wirklich ein verrückter Träumer“, schreibt Udo Grebe. Während die berufliche Lage des Selbstständigen sich nicht annähernd im gleichen Tempo entwickelt, wird das Schiff auf dem Papier immer größer. „Naiv wie ich war, hatte ich zuerst eine 16 Meter lange Yacht gezeichnet“, so Grebe, der dann nüchtern feststellt, dass die Jungen bis zur Abreise wohl heiratsfähig sein würden. „So trennte ich mich von meinen bisherigen Vorstellungen und entwarf eine 23 Meter lange Yacht.“
Jahrelang dient bei Grebes alles nur dem einen Zweck
Auf Außenstehende wirken die Pläne Grebes am Ende naiver als am Anfang. Die enorme Größe des Rumpfes ermöglicht eine Nutzung auf zwei Decks. Grebe schafft dadurch unter dem Deckshaus vier geräumige Kammern mit zwei Bädern. Im Achterschiff ist Platz für einen Salon in den Abmessungen eines veritablen Wohnzimmers. Im Vorschiff ist der großzügige Wohnbereich der Eigner untergebracht.
Auch in technischer Hinsicht setzt Grebe seinen Ideen wenig Grenzen. Den vier Tonnen schweren Kiel und das Ruderblatt plant er hydraulisch aufholbar. Drei Steuerstände sind vorgesehen, eine Haustechnik wie an Land, die entsprechende Versorgung durch generatorerzeugten Strom. Sämtliche Tankkapazitäten folgen den Vorstellungen einer Großfamilie, die autark zu reisen wünscht. Sie fassen vier Tonnen Diesel, sieben Tonnen Frischwasser und 700 Liter Schwarzwasser. Das Rigg soll die Bedürfnisse nach Seefahrerromantik stillen und dennoch leicht zu bedienen sein, Grebe findet auch dafür Lösungen. Zwei aus Oregonpine verleimte Mastprofile und zwei Rahen beherbergen Rollsegel.
Anfang der Achtziger ist alles durchgerechnet und die Konstruktion fertig. Der Großfamiliensegler hat auf dem Papier Gestalt angenommen. Für die Kiellegung aber fehlt das Geld. „Es war eine absurde Situation“, beschreibt Grebe senior selber diese Lebensphase. „Wir wussten nicht, wie es morgen weitergehen sollte, aber ich plante den Bau eines Segelschiffs.“
Um die Situation zu überspielen, fertigt er mit den Söhnen ein Modell im Maßstab 1:10. „Wir konnten ferngesteuert jedes einzelne Segel bedienen“, sagt Marius Grebe und dass die Erfahrungen mit dem Modellschiff von mehr als drei Meter Länge wichtige Erkenntnisse über die Segeleigenschaften brachte. Um festgestellte Fehler auszumerzen, wurde das Heck verändert und der Rumpf noch einmal gestreckt.
Brigantine wird zur Pilgerstätte
Im Jahr 1984 macht sich Udo Grebe mit einer Baufirma selbstständig und erwirbt dafür ein Gewerbegrundstück – so verspricht er es den Banken. Tatsächlich dient alles nur dem einen Zweck. Kaum, dass die Werkhalle errichtet ist, legt Grebe mit seinen drei Jungs los. Am 20. Dezember beginnen sie mit dem Bau der 50 formverleimten Spanten. Es ist der Auftakt zu einer sechs Jahre währenden Ochsentour, während der das Leben der Grebes vom Bootsbau bestimmt wird.
Bald schon errichten sie das auf dem Kopf stehende Spantgerüst, 27 Meter ist es lang, sieben breit, dreieinhalb hoch. In Leistenbauweise nach dem West-System entsteht die Außenhaut aus fünf Lagen Mahagoni. „Das war ermüdend“, sagt Marius Grebe, weil es nach jeder Lage gilt, den gewaltigen Rumpf mühevoll von Hand durchzuschleifen. Doch längst träumen auch die Jungs von der Weltumsegelung.
Den fertigen Rumpf ziehen Traktoren eines Tages aus der Halle, und Mobilkräne helfen, den Koloss auf einem Bett aus Strohballen umzudrehen, bevor er wieder hinter dem Tor verschwindet. Der Ausbau beschäftigt die Grebes nun noch weitere Jahre. „Jeder von uns baute seine Kajüte selber aus. Darüber hinaus haben wir uns aufgeteilt“, so Marius Grebe. Vater Udo schreibt in seinen Aufzeichnungen ausführlich von den Schwierigkeiten. Nicht zuletzt das Geld ist immer wieder Thema, obschon die Baufirma mittlerweile floriert – das wachsende Schiff verschlingt Unsummen. Grebe investiert eine Erbschaft und nimmt Kredite auf.
Um das Deckshaus zu bauen, muss die Brigantine ins Freie und ist fortan Pilgerstätte für Schaulustige und Journalisten aus ganz Norddeutschland. Den Endspurt der Arbeiten flankieren Fernsehauftritte und Zeitungsberichte. Als das Schiff am 22. Mai 1991 zur Küste transportiert, getauft und seinem Element übergeben werden soll, kommen Tausende und verfolgen das Spektakel.
„Maranatha“ ist aramäisch und bedeutet „Unser Herr kommt!“
Grebes werden später mit ihrem „Draht nach oben“ erklären, was an diesem Tag passiert. Weil nämlich ein Straßentransport lediglich zum nächstgelegenen Strand möglich ist, wird das 120 Tonnen schwere Schiff dort auf Luftsäcken ins Wasser geschoben. Dafür bedarf es mehrerer Sondergenehmigungen, die es auch nur ausnahmsweise geben kann, weil dort ohnehin gerade Deichbauarbeiten stattfinden. Während das noch mehr nach überwindbarer Bürokratie denn nach Fügung klingt, ist der Sturm, der einige Tage vorher die Bäume der viel zu engen Allee wegfegt, schwieriger zu erklären. Auch, dass dieser Sturm für den niedrigsten Wasserstand seit Jahrzehnten sorgt und damit die Slipaktion überhaupt erst möglich macht, werten nicht nur die Grebes als Zeichen. Die „Maranatha“ soll offenbar ins Wasser.
Auch als sie endlich schwimmt, ebbt das Interesse der Öffentlichkeit nicht ab. Während die tonnenschweren Masten gestellt werden und das Schiff ausgerüstet wird, ist stets eine Traube von Sehleuten zugegen, an besonderen Tagen auch die Presse. Etwa, als ein gesponserter Flügel im Achterschiff verschwindet, wo er im Salon von Pianist Justus Franz eingespielt wird.
Es scheint, als wäre nach all den Jahren der Fron endlich die Sonne über dem himmlischen Projekt aufgegangen, als die „Maranatha“ am 25. August 1991 unter der Anteilnahme von Tausenden Zuschauern ausläuft, die das gesamte Ufer der Travemündung säumen. An Bord eine 13-köpfige Familiencrew. Die Jungs sind alle verheiratet, zur Besatzung gehören bereits zwei Babys.
Doch die Reise steht unter keinem glücklichen Stern. Die Freude über den Aufbruch wird überlagert von der Erschöpfung, die sich als Ergebnis des jahrelangen Bootsbaus und der Reisevorbereitungen bei allen Beteiligten bemerkbar macht. Erst nach Tagen der Erholung in dänischen Gewässern erreicht die „Maranatha“, die immer noch nicht wirklich fertig ist und mit deren See- und Segeleigenschaften die Crew sich erst noch vertraut machen muss, das Skagerrak und die Nordsee, um auf Südkurs zu gehen.
Doch der ist von verschiedenen Unwägbarkeiten geprägt. Nach Passieren der Jammerbucht bricht das Ruder. Es wird in Esbjerg repariert, was Zeit, viel Geld und den Versicherungsschutz kostet. Die Biskaya wird erst spät im Jahr erreicht, sie zeigt sich entsprechend unwirtlich. Fortgesetzte Probleme mit der Technik und Katastrophen wie ein Brand im Maschinenraum, Schäden durch eine Windhose, die Beinahe-Kollision mit einem Frachtschiff und gefährliche Legerwall-Situationen in Ankerbuchten bringen die Grebes immer wieder an den Rand der Verzweiflung. Als ein Besatzungsmitglied einen medizinischen Notfall erleidet, muss ein afrikanischer Hafen angelaufen werden.
Ein zweites Leben als Motorschiff auf dem Mittelmeer
Als die „Maranatha“ schließlich die Karibik erreicht, ist die Bordkasse leer. Erhoffte Einnahmen aus Medienberichten und dem Buch stellen sich nicht ein. Und nachdem die Familie die Karibik intensiv erkundet hat und Teile der Crew planmäßig abmustern, ist die Luft raus. Der Senior nimmt in Angriff, was ohnehin für das Ende der Reise geplant war – den Verkauf der „Maranatha“. Doch das Interesse ist gering. Eine letzte Familienreise bringt die Grebes und ihr Schiff daher heim in die Lübecker Bucht.
Auch hier ist die Brigantine, trotz ihres Bekanntheitsgrades, schwer verkäuflich – bis Heinz Arnold sich Anfang der 2000er-Jahre in die „Maranatha“ verliebt. Er hat ebenfalls große Pläne, will auf weltweite Fahrt. Doch es kommt nicht mehr dazu, Arnold verstirbt 2005. Und so führt sein Sohn seither Kaufinteressenten durch den Salon, wo einst Justus Franz in die Tasten griff.
Nun endlich, nach vielen Bemühungen, scheint er jemanden gefunden zu haben. Die „Maranatha“ liegt seit einiger Zeit in Rostock und wird umgerüstet. Das Rigg ist bereits verschwunden, die Diesel werden überholt, und dann soll es ein zweites Leben als Motorschiff auf dem Mittelmeer geben.
Eigentlich schade um die aufwändig gebauten Spieren, das liebevoll von Hand bekleedete stehende Gut und die markant grünen Segel. Der Umgang mit ihnen war den Grebes zuletzt in Fleisch und Blut übergegangen. Vier geübte Crewmitglieder genügen nach ihren Erkenntnissen, um den Rahsegler zu fahren. Und dabei passieren manchmal erstaunliche Dinge. Ab Windstärke 5, so berichtet Udo Grebe in seinem Buch, erreicht die mächtige Erscheinung zweistellige Geschwindigkeiten. Dabei, oh Wunder, habe sich die „Maranatha“ sogar selber gesteuert.
Planung und Bau


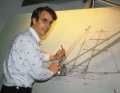



Von der Idee bis zur Fertigstellung vergingen mehr als 20 Jahre. Ein Modell war der sichtbare Beginn des Projekts
Stapellauf und Reise






Nach Zeitungsartikeln und Fernsehauftritten ist die „Maranatha“ nicht nur unter Seglern bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Tausende nehmen Anteil, als sie zu Wasser geht
Technische Daten der “Maranatha”

- Konstrukteur: Udo Grebe
- Erbauer: Familie Grebe
- Bauzeit: 1984–1991
- Gesamtlänge: 34,00 m
- Rumpflänge: 27,00 m
- Breite: 7,00 m
- Tiefgang: 2,00–4,00 m
- Gewicht: 120 t
- Segelfläche: 600 m2
- Antrieb (DAF-Diesel): 2 x 120 PS
Der Artikel erschien erstmalig in YACHT-Ausgabe 05/2020 und wurde für die Onlineversion überarbeitet.

