
Zum Sinken so vieler Yachten im Hafen wie bei der Ostsee-Sturmflut bedurfte es mehrerer Komponenten. Der hohe Wasserstand in Kombination mit Wellen, die durch manchen Hafen liefen, erzeugten Lastspitzen auf Festmachern und Stegen, die diesen oftmals nicht gewachsen waren. Hinzu kam der orkanartige Wind.
Was es bedeutet, wenn viel Wind seitlich vor allem auf moderne Yachten trifft, zeigt das Beispiel einer 10-Meter-Yacht.
Moderne Yachten haben enorme Angriffsflächen
In den vergangenen Jahrzehnten ging die Konstruktionsentwicklung immer mehr in Richtung Volumen über der Wasserline (siehe Galerie).



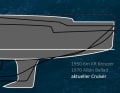

Wenn man sich ein Viereck um die projizierte Fläche vorstellt, so wird dieses Viereck von modernen Yachten immer mehr ausgefüllt. Wegen gerader Hecks und Steven, viel Freibord sowie hohen und langen Aufbauten.
Diese bieten dem Wind enorme Angriffsflächen. Davon merkt man bei moderaten Verhältnissen meist wenig, da bei geringem Wind auch der Winddruck auf diese Flächen eher schwach ist. Der Druck auf Rumpf und Rigg nimmt jedoch im Quadrat zur Windgeschwindigkeit zu. So bedeutet der Unterschied zwischen drei Windstärken und neun Windstärken nicht etwa eine Verdreifachung des Winddruckes sondern fast das 21-Fache.
Winddrücke auf eine Fläche von einem Quadratmeter mit cw = 1
Auch die Riggs bieten mehr Angriffsfläche
Zu den größer werdenden projizierten Flächen kommt ein weiterer Aspekt. Bei der Rigggestaltung verlagern sich die Segelflächenanteile immer mehr zugunsten des Großsegels. Die Masten und Großbäume werden länger. Angenommen, der Mast einer Zehn-Meter-Yacht ist etwa 13 Meter lang. Bei einer Profiltiefe von 25 Zentimetern ergibt sich eine projizierte Fläche von 3,3 Quadratmetern, das entspricht in etwa einem Opti-Segel!
Hinzu kommen Vorsegel-Rollanlagen; kaum ein Fahrtensegler verzichtet heute darauf. Bei rund zwölf Meter Vorliekslänge ergibt die aufgerollte Tuchwurst bei einem Durchmesser von nur zehn Zentimetern, was wenig wäre, eine projizierte Fläche von 1,2 Quadratmetern. Oder Lazy-Bags: Baumlänge 4,5 Meter, Höhe des Bags rund 40 Zentimeter – ergibt 1,8 Quadratmeter. Diese noch dazu in rund drei Meter Höhe über der Wasseroberfläche, da die Großbäume höher als früher angeschlagen werden, um geräumige Sprayhoods zu ermöglichen.
Alles in allem bietet ein durchschnittliches Zehn-Meter-Fahrtenboot über der Wasserlinie mehr als 20 Quadratmeter Windangriffsfläche; Stage, Wanten, Salinge, Bug- oder Heckkörbe, Sprayhood oder gar Kuchenbuden noch nicht einmal mitgerechnet. Das entspricht bei Beaufort 7 360 Kilogramm, wohlgemerkt in Ruhe, noch nicht beschleunigt.
Nun müssen diese fast 360 Kilogramm aber nicht vollständig von den Festmachern gehalten werden, denn erstens kommt der Wind nicht immer genau von der Seite, zweitens stehen nicht alle Flächen der Projektion senkrecht.
Dennoch wird anhand der Zahlen klar, welch enorme Lasten allein durch den Wind erzeugt werden können. Da ist in der Vorbereitung auf Sturm im Hafen jeder Quadratmeter entscheidend, der aus dem Wind genommen werden kann.
Welche Lasten entstehen, wenn es nicht nur entsprechend weht, sondern die meist tonnenschwere Yacht mit ihrer von Wellen beschleunigten Masse in die Festmacher einruckt, in nicht genau bekannt. Dass sie aber ein Vielfaches dessen ausmachen können, was allein der Wind verursacht, ist nur logisch.
Wie viel halten Festmacher aus?
Einige Verluste hätten sich sicher auch mittels besserer Festmacher vermeiden lassen. Eine alte Schot oder Ähnliches ist für die Verwendung als Festmacher eine ganz schlechte Wahl. Solche meist alten und ausgereckten Leinen besitzen nur noch einen Bruchteil ihrer Haltbarkeit.
Bei modernen Festmachern, welche speziell zu diesem Zweck konstruiert sind, sind drei Faktoren entscheidend: die Arbeits- und Bruchlast sowie das Dehnungsverhalten. Genaue Angaben dazu liefert unser Tauwerk-Test. Zwar haben die dort getesteten Festmacher von 14 Millimeter Stärke für eine 10-Meter-Yacht eine Bruchlast von über vier Tonnen. In der Praxis spielt die Bruchlast eines Festmachers aber nur indirekt eine Rolle, aus ihr wird die Arbeitslast abgeleitet. Nach den Empfehlungen der Klassifizierungsgesellschaft DNV GL sollte sie höchstens 20 Prozent der Bruchlast betragen, was bei den Testkandidaten Werten zwischen 735 und 1.128 Dekanewton entspricht. Höhere Arbeitslasten bieten Spielraum für mechanische Beschädigungen des Seils.
Und ist ein Festmacher erst einmal in Mitleidenschaft gezogen, reduziert sich dessen Bruchlast dramatisch, im Test teilweise auf weniger als die Hälfte.
Je mehr Dehnung, desto mehr Energieaufnahme
Wichtig ist ebenso das Dehnungsverhalten. Die Energie, die in das Tauwerk zu dessen Dehnung fließt, kommt nicht am Beschlag an Bord oder auf dem Steg an. Auch in diesem Punkt unterschied sich das getestete Tauwerk deutlich.
Was Festmacher können sollen
- Hohe Dehnung: Je mehr Energie die Leine durch Längenänderung aufnehmen kann, desto weicher ruckt das Schiff ein, was die Belastung für Klampen verringert und den Aufenthalt an Bord komfortabler gestaltet.
- Hohe Bruchlast: Die nötige Bruchlast richtet sich nach der Schiffsgröße. Schon kleine Scheuerstellen schwächen das Tauwerk stark, daher sollte eine Reserve eingeplant werden.
- Robust: Rostige Eisenringe, Kaianlagen aus Beton oder die Lippklüsen mit Gussnähten: Die Liste der möglichen Scheuerstellen ist lang. Durch Schwell und Wind sind die Festmacher praktisch immer in Bewegung. Diesen Dauerstress überstehen nur sehr robuste Konstruktionen.
- Lehnig: Je geschmeidiger die Leine ist, desto besser lässt sie sich belegen und aufschießen.
Knoten schwächen Leinen
Dass Knoten die Festigkeit der Leine herabsetzen, ist bekannt – aber wie stark lässt die Bruchlast nach? Wir haben die gängigsten Knoten zum Verbinden zweier Leinen untersucht – und zwar jeweils mit 10 Millimeter starkem Tauwerk. Bei Polyestertauwerk tragen Kern und Mantel fast zu gleichen Teilen. Daher ist es kein Problem, dass sich im Knoten hauptsächlich der Mantel bekneift. Anders verhält es sich es bei Dyneemaleinen, sie beziehen ihre Festigkeit fast ausschließlich aus dem sehr glatten Kern. Rutscht dieser im Knoten, verlagert sich zu viel Last auf den Mantel – und er bricht.
Der bei Festmachern häufig verwendete Palstek etwa verringert die Bruchlast der Leine um 73 Prozent!
Nicht am Festmacher sparen
Wind und Wellen können also auch auf einer Yacht im Hafen enorme Lasten erzeugen , die von den Festmachern aufgenommen werden müssen. Selbst bei modernem Tauwerk verringert sich dessen Bruchlast wegen Knoten oder Schadstellen. Jedoch braucht man diese Schwächungen nicht zu addieren, der Festmacher bricht immer nur aus einem dieser Gründe: unterdimensioniert, Knoten vorhanden, Schadstellen vorhanden. Deshalb bei Festmachern Folgendes beachten:
- lieber eine Festmachergröße höher wählen, als für die eigene Yacht empfohlen
- möglichst viele Festmacher an verschiedenen Anschlagpunkten ausbringen, um die Lasten zu verteilen
- an Pfählen: Festmacher mit einem durchgesteckten Auge, das sich selbst bekneift, gegen Hochrutschen am Pfahl sichern

