



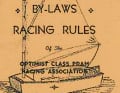

Von Michael Timmermann
Vor 76 Jahren begann die wohl größte Erfolgsgeschichte einer Bootsklasse. Dass der Optimist heute mit geschätzt einer halben Million weltweit segelnder Boote die größte internationale Regattaklasse wurde, verdankt er einer genialen Idee und vielen Zufällen. Dies ist seine Geschichte.
Die Konstruktion der kleinen Segelkiste wurde im Jahr 1947 von dem Bootsbauer Clark Mills in der amerikanischen Kleinstadt Clearwater entwickelt, in Florida am mexikanischen Golf. Den Auftrag zum Bau der ersten Boote erhielt Mills von seinem Freund Major Clifford McKay, Manager des örtlichen Radiosenders TWAN. Als Gastredner im Optimist Club of Clearwater hatte McKay dem Verein Wettbewerbe mit kleinen Booten in der geschützten Bucht vor der Stadt vorgeschlagen.
Von der Seifenkiste zum Boot
Der Optimist Club of Clearwater ist eine wohltätige Organisation, die sich auch heute noch für die Freizeitgestaltung benachteiligter Kinder einsetzt. Und dazu gehörte seinerzeit auch die Veranstaltung von Seifenkistenrennen in Clearwater.
Diese Rennen durchzuführen war jedes Mal sehr aufwändig, denn in der Gegend gibt es nur wenige geeignete Berge, und es mussten immer viele Straßen gesperrt werden. Am 14. August 1947 unterbreitete Major McKay dem Club nun seine Idee, die Seifenkisten aufs Wasser zu verlegen.
Sein Vorschlag war es, das Spektakel mit eigens anzufertigenden kleinen Booten auf die weite und geschützte Bucht vor der Stadt zu verlegen. Nach den Vorstellungen McKays sollten diese – wie die bisher üblichen Seifenkisten auch – von einem Vater mit seinem Sohn ohne besondere Kenntnisse und Hilfsmittel in kurzer Zeit selbst gebaut werden können.
Der Optimist erhält seine Grundzüge
Kern der Idee war daher die Einfachheit der Konstruktion. McKay ging dabei so weit, dass ihm ein Segel aus Betttüchern vorschwebte. Und schließlich sollte das Boot auch nicht mehr als 50 US-Dollar kosten, denn so viel gab der Verein als Sponsor bis dahin für den Bau einer Seifenkiste.
Mit diesen Vorgaben stellte McKay seinen Freund, den Bootsbauer Clark Mills, vor große Herausforderungen. Nach einigen Versuchen aber gelang ein Entwurf, der die Forderungen zu erfüllen versprach. Der entscheidende Punkt war eine platte Frontpartie. Die erleichterte den Selbstbau und lieferte trotz der geringen Größe des Bootes den nötigen Auftrieb im Vorschiff.
Die Maße ergaben sich aus der Länge der günstigsten Sperrholzplatte. Aus vier Platten von acht mal vier Fuß konnten bei nur geringem Verschnitt ganze drei Boote gebaut werden.
Das Boot wurde auf Englisch Optimist Pram oder nur Pram genannt, weil seine Form mit ihrem platten Bug an die gleichnamigen Transportfahrzeuge erinnert.
Der erste Optimist wurde in 1,5 Tagen gebaut
Da das Ergebnis schon in der nächsten Versammlung des Clubs vorgestellt werden sollte, blieben Clark Mills, nachdem er bereits eine Woche auf die Konstruktion verwendet hatte, für den Bau des ersten Prototyps nur noch eineinhalb Tage Zeit.
Doch das Vorhaben gelang, und am Nachmittag des 3. September 1947 konnte McKays elfjähriger Sohn in der Bucht vor dem Dunedin Boat Club auf Jungfernfahrt gehen.
Sein Vater nahm den Prototyp anderntags mit zur Versammlung des Optimist Club und stellte ihn dessen Mitgliedern am Donnerstag, dem 4. September, in der Vorhalle des Hotels „Gray-Moss-Inn“ vor. In der anschließenden Abstimmung nahm der Club das Projekt an. Der Opti war geboren. Und sowohl sein Name als auch das Klassenzeichen zeugen noch heute von den Ursprüngen im Optimist Club of Clearwater.
V on ihrer Erscheinung her unterschieden sich die ersten Optis allerdings noch etwas von den heutigen. Die vollständig in Holz gebauten Boote waren auch nach einer Kenterung schwimmfähig und brauchten deswegen noch keine Auftriebskörper. Aber der Ur-Opti war schon sprietgetakelt, und bis um 1972 waren Mast, Baum und Spriet aus Holz gefertigt, anfangs auch noch bei den späteren Rümpfen aus Kunststoff.
McKay war kein Segler und seine ursprüngliche Idee, das Segel aus einem Betttuch zu schneidern, hatte Mills ihm glücklicherweise bald ausgeredet. Die viereckige Form eines Bettlakens soll Mills aber zur Spriettakelung angeregt haben.
Der Optimist blieb lizenzfrei
Die finanziellen Hürden für die angehenden Opti-Segler waren bewusst klein gehalten worden. Clark Mills selbst verdiente am Bau eines Bootes nur fünf Dollar. Und da auch der örtliche Rotary Club gleich zu Anfang zehn der kleinen Schiffe finanzierte, wuchs die Flotte in Clearwater schnell auf mehr als 25 Optis an.
Die Rümpfe wurden von den Seglern selbst lackiert und mit dem Rigg versehen. Im Laufe der nächsten Jahre fertigte Mills in seiner Werft insgesamt zirka 200 Optis an. Gegen ein geringes Entgelt verkaufte er die Pläne auch. Lizenzgebühren für Nachbauten hat er niemals verlangt. Die Rechte hatte er kostenlos an den Optimist Club of Clearwater abgetreten.
Erste Regatten mit dem Optimisten
Die Regatten wurden ganzjährig an jedem zweiten Sonntag im Monat veranstaltet. Die Meldegebühr betrug einen Dollar pro Jahr und musste vom Opti-Segler selbst verdient worden sein.
Es gab zwei Wertungsgruppen, und ab 1948 waren auch Mädchen zugelassen. Die Boote waren dabei einem bestimmten Segler zugeteilt, und bei der Siegerehrung wurde der Sponsor zusammen mit seinem jeweiligen Segler genannt.
Auch die örtlichen Zeitungen und das Radio berichteten regelmäßig von den Wettbewerben. Am Heck des Optis konnte und sollte der Sponsor, dem die Jolle auch gehörte, für sich werben. Diese Werbeaufschrift war das Unterscheidungsmerkmal der Boote und ersetzte die heute übliche Segelnummer.
Bald luden sich benachbarte Vereine gegenseitig zu Regatten ein. Die Optis wurden dann mit Möbelwagen transportiert. Die Wettbewerbe fanden nach festen Regeln statt, die von einer Kommission des Optimist Club of Clearwater festgelegt wurden. Für Segler gesponserter Boote war die Teilnahme an den Regatten Pflicht. An den Nachmittagen nach der Schule fuhren die Kinder mit ihren Jollen in den Mangrovensümpfen der Bucht vor Clearwater von Insel zu Insel, ohne jegliche Aufsicht und auch ohne Rettungswesten, denn Westen für Kinder gab es noch nicht.
Die einzigen Auflagen waren, dass ein Boot nicht allein auslaufen durfte und die Optis in Sichtweite bleiben mussten. Das Segeln haben sich die ersten Opti-Segler also in völliger Unbekümmertheit selbst beigebracht. Dabei stellten sie erstaunt fest, dass der Opti auch bei mehr als 20 Knoten Wind noch segelbar ist, ohne Schwimmweste, ohne Auftriebskörper und ohne Trainerbegleitung wohlgemerkt.
„Life was simpler“, stellt Clifford McKay in seinen Erinnerungen hierzu fest, „das Leben war einfacher“. Und weiter: „In unserer Jugend verbrachten wir beinahe so viel Zeit auf dem Wasser wie an Land.“
Der Wettkampf ergab sich zwangsläufig, denn überall, wo mehr als zwei Boote zusammen auf dem Wasser sind, ist es immer auch ein Rennen.
Im benachbarten Dunedin Boat Club gab es bald auch erste Schulungen im Opti-Segeln, allerdings noch ohne die heute übliche Begleitung durch den Trainer auf einem Motorboot.
Die ersten Optimisten verbrennen
Bis zum Frühjahr 1949 war die Flotte in Clearwater schon auf 29 Boote angewachsen, die in einer Fischerhütte neben dem Dunedin Boat Club gelagert wurden. In der Nacht zum 20. April 1949 brannte diese dann aber vollständig nieder, und alle gelagerten Optis fielen dem Feuer zum Opfer. Das Projekt schien am Ende.
Doch der örtliche Radiosender TWAN und die Zeitungen berichteten von dem tragischen Unglück. Die Hilfsbereitschaft war überwältigend. Das Telefon stand nicht still, und innerhalb von nur zwei Stunden kam das Geld für 43 neue Boote und darüber hinaus weitere 6.000 Dollar zum Bau eines neuen Bootshauses zusammen. Es erscheint paradox, aber der Brand verhalf dem Opti zu mehr Popularität.
Der Optimist gelangt nach Europa
Im Jahr 1954 fielen die Boote dem dänischen Architekten Axel Damgaard bei einer Reise auf, und er brachte den Bauplan mit nach Dänemark. Im Königlich Dänischen Yachtclub in Kopenhagen wurden nach diesen Plänen die ersten europäischen Optis gebaut. Mit Paul Elvstrøm, einem international bekannten und sehr erfolgreichen Segler, fand der Opti in der Folge einen einflussreichen Unterstützer. Dank seiner Hilfe verbreiteten sich die Boote über Skandinavien in ganz Europa.
Die ersten Optis in Deutschland wurden 1962 im heutigen Warnemünder Segelclub gesegelt. Im Vorjahr hatte eine Gruppe junger Segler aus Dänemark an der DDR-Segelwoche in Warnemünde teilgenommen und dem Verein eines der Boote und einen Bauplan zum Gastgeschenk gemacht.
In diesen ersten Jahren gab es nur Pläne oder Bausätze in Holz zu kaufen, und es existierten noch viele unterschiedliche Bauformen. Besonders in Skandinavien wurde die Konstruktion später den Bedürfnissen und Vorstellungen der Opti-Segler entsprechend weiter verbessert. Über die Bauvorschriften herrschte aber nicht immer Einigkeit.
Gründung der Optimisten-Vereinigung
Um die Klasse dennoch zusammenzuhalten, wurde 1960 in Finnland die International Optimist Dinghy Association (IODA) gegründet. Unter der Leitung von Viggo Jacobsen wurde das Boot dann 1973 in einem spektakulären nächtlichen Alleingang der IODA in seiner Bauform als „International Optimist Dinghy“ zur verbindlichen Einheitsklasse erklärt. „Clark had built a boat. Viggo had built a Class“, so Robert Wilkes als sein Nachfolger später.
Bis 1985 existierten in den USA zwei unterschiedliche Bauweisen nebeneinander, der Original-„Optimist Pram“ nach dem Vorbild von 1947 aus Clearwater, und das in Europa weiterentwickelte „International Optimist Dinghy“.
Dessen Abmessungen sind im Wesentlichen die des historischen Vorbildes geblieben. Die Bootsgeschwindigkeit hat sich besonders durch die von Paul Elvstrøm beeinflusste Einführung des ausgestellten und gelatteten Segels entscheidend verbessert.
In den siebziger Jahren hielt Kunststoff als Baumaterial Einzug und wurde wegen des geringeren Pflegeaufwands zunächst vor allem in Segelschulen geschätzt. Die Spitzensegler bevorzugten dagegen noch lange ihre vertrauten und damals leichteren Holzkonstruktionen.
Bereits nach sechs Jahren wurden allein in Florida mehr als 1.000 Optis gezählt. Inzwischen schätzt man die Flotte der organisierten Opti-Segler auf 170.000 Boote in 115 Ländern. Insgesamt dürften weltweit eine halbe Million existieren. Zur Eröffnung der Olympischen Spiele 1972 in Kiel traten fast 300 Optis als Rahmenprogramm auf, und Clifford McKay verfolgte das Spektakel am Fernseher.
Ursprünglich als anfängertaugliches und stabil segelndes Boot für geschützte Gewässer konstruiert, hat sich der Opti durch behutsame Verbesserungen und die Bauweise in Kunststoff mit Alu-Rigg zu einem ausgereiften Sportgerät entwickelt.
Konstruktionsbedingt sind dem Geschwindigkeitspotenzial allerdings Grenzen gesetzt. Denn im Wesentlichen ist der Opti das einfache Boot von Clark Mills aus dem Jahr 1947 geblieben, auch wenn es sich inzwischen vom ursprünglich sozialen Projekt zu einer Freizeitbeschäftigung für privilegierte Kreise entwickelt hat.
Anfangs wurde der Opti als Kinderspielzeug belächelt, und auch der Deutsche Segler-Verband war dem Jüngstenboot gegenüber lange Zeit kritisch eingestellt. In seiner mehr als 25 Jahre dauernden Zeit als Vorstand der Deutschen Optimist-Dinghy Vereinigung hat Günther Nülle den Opti aber gegen alle Widerstände zu einem unabdingbaren Bestandteil des Angebotes engagierter Segelvereine gemacht.
Aus keiner Segel-Zeitschrift ist der Opti heute noch wegzudenken. Viele berühmte Segler haben ihre Karriere im Opti begonnen, einem Boot, das wie ein Pferdetrog aussieht, aber dennoch oder vielleicht gerade deswegen weltweite Begeisterung weckt. Die Erfolgsgeschichte des Optis ist beispiellos.
Renaissance des Ur-Optis
Der Autor ist seit rund 20 Jahren Opti-Trainer am Starnberger See und Initiator des Fördervereins 1947 Optimist Prahm. Der Verein bietet Regattaveranstaltungen nach Art der Segel-Bundesliga auf klassischen Optis an. Die alternativen Regatta-Formate sollen die Unbeschwertheit und den Geist des ursprünglichen Opti-Segelns vermitteln. Verwendet werden regattatauglich restaurierte Boote, die vor 1995 vorzugsweise in Holz gebaut wurden, jedoch mit einem modernen Segel ausgestattet sind.
Der Weg zur deutschen Jüngsten-Regattaklasse
- 1954 Der Opti kommt über Dänemark nach Europa. Einführung von Segeln aus Dacron
- 1958 Erste Erwähnung des Optimisten in der Zeitschrift „Die Yacht“
- 1960 Gründung der International Optimist Dinghy Association (IODA) in Finnland
- 1961 In Deutschland werden die ersten Optis in Warnemünde (DDR) gebaut
- 1962 In England findet die erste, noch inoffizielle Weltmeisterschaft statt
- 1967 Gründung der Deutschen Optimist-Dinghy Vereinigung (DODV) durch Hans Harro Redlefsen in Schleswig-Holstein
- 1968 Erste A-/B-Regelung (altersabhängig)
- 1969 Erste (noch inoffizielle) Deutsche Meisterschaft in Kiel-Schilksee
- 1970 Rümpfe aus Kunststoff werden erlaubt
- 1971 Erste (noch inoffizielle) Meisterschaft in Malente, Schleswig-Holstein
- 1972 Alumasten setzen sich durch, bei den Olympischen Spielen in Kiel-Schilksee bilden rund 300 Optis ein Rahmenprogramm
- 1973 Der Opti erhält den Status einer internationalen Klasse und das Klassenzeichen
- 1974 Erste vom Deutschen Seglerverband (DSV) anerkannte Deutsche Meisterschaft
- 1975 Der Opti wird vom DSV als offizielles Jugendboot nominiert
- 1985 Neue Baubestimmungen für Kunststoffboote
- 1995 Erste weltweite Vereinheitlichung der Bauvorschriften durch die IODA
- 2005 In St. Moritz gewinnt Tina Lutz zum ersten Mal für Deutschland die Weltmeisterschaft der Optimisten
- 2006 In Uruguay wird Deutschland mit Julian Autenrieth erneut Weltmeister
- 2008 Paulina Rothlauf gewinnt für Deutschland die Europameisterschaft am Gardasee
- 2009 Paulina Rothlauf wird erneut Europameisterin
- 2011 Gründung des Deutschen Optimist-Museums in Esgrus/Schleswig-Holstein (2020 aufgelöst)
- 2013 Nils Sternbeck wird Vize-Weltmeister auf dem Gardasee
- 2014 Nach mehr als 25 Jahren scheidet Günther Nülle aus dem Vorstand der deutschen Klassenvereinigung aus

