


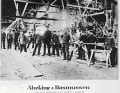


- Der Beginn einer Legende
- Pioniere des Yachtbaus
- Kindheit und erste Erfahrungen
- Ausbildung und Weg zur Werftgründung
- Selbstständigkeit und Gründung von Abeking & Rasmussen
- Herausforderung und Expansion
- Handwerkliche Qualität und Innovationskraft
- Die "Königin II" und ihre Geschichte
- Innovation und Exzellenz im Regattasport
- Einfluss des Deutschen Segler Verbands
- Der Einfluss der International Rule
- Herausforderungen in der Nachkriegszeit
- Die Rolle der Starboote
- Skandinavische Lösung und neue Partnerschaften
- Erneute Aufträge aus den USA
- Der Einfluss amerikanischer Kunden
- Der plötzliche Einfuhrzoll
- Rückkehr des deutschen Marktes
- Wiederaufbau und Erneuerung
- Ein neues Wirtschaftswunder
Der Beginn einer Legende
In Zeiten, in denen Boote und Yachten auf genormten Fertigungsstraßen entstehen und von Industriebetrieben in Serie geliefert werden, ist kaum vorstellbar, welche Schöpferkraft und Handfertigkeit den Segelsport einst getragen haben. Segeln als preisgünstiger Massensport begann, als in den 1960er Jahren neue Erfindungen wie GFK das Holz als Baustoff ersetzten. „Frozen snot“, „gefrorener Rotz“, nannte L. Francis Herreshoff (1890–1972) aus der legendären US-Bootsbauerdynastie die Glasfaserprodukte aus der Form verächtlich.
Pioniere des Yachtbaus
Es waren vor allem drei Männer, die den Yachtbau aus Holz international prägten. Sie waren nicht nur geniale Konstrukteure, Bootsbauer und Erfinder, sondern auch hervorragende Segler, die sich zudem in der Welt ihrer Kunden, die zumeist dem Großkapital entstammten, bewegten wie Fische im Wasser: Nathanael Greene Herreshoff (1848–1938), „der Zauberer aus Bristol“ an der US-Ostküste; Charles Ernest Nicholson (1868–1954) aus Gosport an der englischen Südküste und Henry Rasmussen (1877–1959) in Lemwerder an der Weser. Was machte „Jimmy“ Rasmussen, wie er genannt wurde, so einzigartig?
Kindheit und erste Erfahrungen
In seinen Lebenserinnerungen schrieb er 1956: „Ich hatte eine schöne Kindheit voller Romantik. Mein Elternhaus lag wenige Schritte vom Wald entfernt. Soweit das Auge reicht, sah man nur Wald und mehr Meer und dazwischen Kornfelder mit Höfen.“ Geboren wurde Henry Rasmussen am 15. Januar 1877 in Svendborg im Königreich Dänemark, an einem der schönsten Segelreviere der Welt. Die große Familie Rasmussen lebte als Bauern und Bootsbauer am Svendborgsund, einer idyllischen Meerenge.
So wuchs der junge Henry Rasmussen mit Landwirtschaft und Jagd auf, aber das Wasser faszinierte ihn. Er ging noch nicht zur Schule, als er mit zwei Freunden seine erste Segelreise mit einer heimlich besorgten Fischerjolle unternahm: zwei Masten, zwei Sprietsegel. Auf dem ersten Kreuzkurs, bei zunehmendem Wind und Seegang, drohte der Großmast zu brechen. Sie bargen das Segel. Unter Besansegel konnte der Kahn beim Wenden nur noch mithilfe der Riemen durch den Wind gebracht werden. Es waren Jimmys erste, prägende Erfahrungen in Seemannschaft mit Wind und Welle und der Physik des Segeltrimms.
Ausbildung und Weg zur Werftgründung
Im Jahr 1895 begann Rasmussen seine Ausbildung zum Bootsbauer auf der Werft seines Großvaters in Svendborg. Tatsächlich hatte er schon so viel gelernt, dass er vom ersten Tag seiner Lehre an als vollwertiger Bootsbauer eingesetzt wurde. Es folgten weitere Stationen auf Werften in Odense, Kopenhagen und Tönning. „Gesegelt wurde in jeder freien Stunde, und stets versuchte man irgendeinen zu finden, mit dem man anliegen konnte“, schrieb er später.
In Kopenhagen besuchte Rasmussen die Schiffbauakademie, die er als Schiffbauingenieur abschloss, um anschließend ein Angebot der 1892 gegründeten Bremer Vulkan Werft anzunehmen und nach Bremen-Vegesack zu ziehen. Hier an der Unterweser fand der Däne eine neue Heimat und nahm später auch deren Staatsbürgerschaft an.
In der reichen Handelsstadt Bremen gehörte Segeln zum guten Ton. Neben seiner Arbeit auf der Großwerft konstruierte er seine ersten Boote. Für den Reeder Heinrich Hilken zeichnete er die Sechs-Segellängen-Yacht „Durch“, ein dem Starboot ähnliches Regattaboot. Der Neubau entstand 1903 auf der Werft seines Freundes Friedrich „Fidi“ Lürssen. Lürssen konzentrierte sich später ganz auf den Bau von Motoryachten. Rasmussen weiß, warum: „Onkel Fidi hatte im Bau von Segelyachten ein Haar gefunden. Die Boote würden, wie er sagte, nie fertig, und immer hätten die Segler etwas zu quaken.“
Selbstständigkeit und Gründung von Abeking & Rasmussen
Als Yachtkonstrukteur galt Rasmussen bald als erste Adresse. Bevor aber die Baunummer 1 auf der eigenen Werft zu Wasser kam, machte er noch einen Ausflug ins nahe Emden. Sein Arbeitgeber, die Vulkan, hatte ihn 1903 als Betriebsleiter zu der im Aufbau befindlichen Großschiffswerft Nordseewerke dorthin geschickt. In Emden gründete Rasmussen einen Werft-Segelclub, und aus diesem Kreis kamen weitere Aufträge.
Der Kaiser segelte, seine Untertanen taten es ihm nach, der Segelsport erlebte seine erste große Blüte – eine gute Zeit, um sich selbstständig zu machen. „Es war im Sommer 1907, als wir uns entschlossen, eine Yacht-und Bootswerft zu gründen“, so der gerade 30-Jährige. Einen Partner fand er in dem Maschinenbauingenieur Georg Abeking, einem Kollegen von der Emder Werft. Auf dem ländlich geprägten linksseitigen Weserufer erwarben Abeking & Rasmussen von der oldenburgischen Regierung ein passendes Wassergrundstück. Mit dem Bau einer ersten Halle wurde sofort begonnen.
Herausforderung und Expansion
In der Gemeinde Lemwerder regte sich Widerstand. So schickte sie eine Abordnung zum Landesherrn Friedrich August Großherzog von Oldenburg, um eine Beschwerde vorzutragen. Das war die falsche Adresse. Der Großherzog war Segler. Er besaß sogar ein Kapitänspatent und unternahm an Bord seiner Staatsyacht „Lensahn“ – ein 62 Meter langer Schoner mit 1.000-PS-Dampfmaschine – viele Reisen.
Auf die Frage, was seine Landeskinder wohl auf dem Herzen trügen, entspann sich folgender Dialog: „Dat will ick Se woll seggen, Herr Großherzog: Wi kömmt von wegen de Warft!“ – „Wat is denn mit de Warft?“ – „De nehmt uns de ganze Utsicht.“ – „Denn möt ji en Utsichtstorm boen, denn könnt ji boben utkieken“, beschied der Landesherr.
Der Weg war frei. Rasmussen machte sich sofort an die Arbeit. Er zeichnet und baut. Schon im Gründungsjahr betrug der Auftragsbestand 16 Boote und Yachten. Die Baunummer 1 erhielt ein Fünf-Meter-Arbeitsboot für die Werft.
Im folgenden Jahr 1909 konnten die Baunummern 17 bis 69 abgeliefert werden, darunter eine gaffelgetakelte Fünf-Meter-R-Yacht auf eigene Rechnung, die er „Frisia“ taufte und unter dem Stander des Weser Yacht Clubs an den Regattastart brachte. Das Jahr 1910 endete mit der Baunummer 166.
Handwerkliche Qualität und Innovationskraft
Rasmussens Boote bestachen nicht nur durch ihre handwerkliche Qualität und viele technische Neuerungen. Er war auch ein Fuchs im Ausnutzen der Vermessungsregeln. Am Segelsport reizte ihn stets der Wettbewerb, und da konnte ihm keiner etwas vormachen, weder am Reißbrett noch an der Pinne.
Zeigte sich ein Eigner mit der Performance seines Neubaus nicht zufrieden, setzte sich der Werftchef selbst ans Rohr und sammelte Silberpokale, nicht nur bei den wichtigsten Regatten in Deutschland, sondern auch in Dänemark.
Die "Königin II" und ihre Geschichte
An Bord der Sechs-Meter-R-Yacht „Aster“ nahm er einmal mit dem Hamburger Kaufmann von Eicken an der Øeresundwoche vor Kopenhagen teil. Rasmussen: „Wir segelten den Sechser mit drei Mann, davon ein Bootsmann. An einem Tage war es so hart, dass unser Bootsmann sich weigerte, den Spinnaker zu setzen. Er war überzeugt davon, dass wir doch versaufen, und wozu sich vorher die Arbeit machen mit dem Spinnakersetzen?“
Die Anzahl der Neubauten ging in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg etwas zurück, dafür wurden die Yachten deutlich größer. 1912 verließ die 22 Meter lange Yawl „Königin II“ als bislang größtes Schiff die Werft. Auftraggeber war Waldemar Baron von Dazur, ein schlesischer Rittergutsbesitzer und Führer einer Jagdfliegerstaffel im Ersten Weltkrieg. Zu den späteren Eignern der Tourenyacht gehörte Benito Mussolini, der an Bord seine Geliebte Claretta Petacci unterhielt.
Innovation und Exzellenz im Regattasport
Die „Königin II“ gibt es heute noch. Sie heißt jetzt „Fiamma Nera“, übersetzt „Schwarze Flamme“, liegt im Mittelmeer und dürfte mit 113 Jahren unter dem Kiel die älteste Hochseeyacht von Rasmussen sein, die nach wie vor segelt.
Rasmussen wusste seine Kunden mit Charme, vor allem aber mit Können und Innovationen zu akquirieren. Das half bei der wichtigsten Einnahmequelle, den Regattayachten: Wer an der Spitze mitsegeln will, der muss sich bei jeder Änderung der Vermessungsregeln mit einem Neubau, wenigstens aber einem Umbau, entsprechend positionieren.
Einfluss des Deutschen Segler Verbands
Um die Voraussetzungen für faires Regattasegeln zu ermöglichen, gründeten die führenden Segelvereine 1888 den Deutschen Segler Verband (DSV), der die Messbriefe ausgab. Für das Regelwerk war der Technische Ausschuss des DSV zuständig. Als ehrenamtlicher Mitarbeiter war Rasmussen 50 Jahre in dieser Abteilung tätig und wurde so zum Geburtshelfer mancher neuen Klasse, die zunächst vorzugsweise in Lemwerder gebaut wurde.
Als Konsequenz der zunehmenden Internationalisierung des Segelsports wurde 1907 die International Yacht Racing Union (IYRU) als Weltdachverband gegründet, deren technischer Abteilung er auch beitrat.
Der Einfluss der International Rule
Die Deutschen übernahmen die 1906 eingeführte International Rule, die einen Siegeszug für R Yachten auslöste, nicht zum Schaden von A&R. Ihr erstes nach der neuen Regel gebautes Boot war die Sieben Meter R Yacht „Albert“, Baunummer 5. Bei der ersten Frühjahrsregatta des Weser Yacht Clubs schlug der Neubau, mit Rasmussen an der Pinne, die Konkurrenz um zehn Minuten. So was sprach sich herum.
Während Rasmussen in den Wintermonaten seine Aufträge am Zeichentisch und in den Werfthallen abarbeitete, war der Sommer dem Segeln und der Akquisition von neuen Aufträgen vorbehalten.
Um den „Zauberer von der Weser“ kennenzulernen, gab sich die deutsche Segelprominenz bei ihm die Klinke in die Hand. Dazu gehörte auch der segel-interessierte Prinz Henrich von Preußen, Großadmiral und Bruder des Kaisers. Diese Freundschaft hielt bis zum Tod des Prinzen im April 1929.
Herausforderungen in der Nachkriegszeit
Neben den reinen Segelyachten erwarb sich die Werft bald auch ein Standbein mit dem Bau von Motorbooten und Fahrzeugen für Behörden und die Marine. Das half dabei, auch die schwierigen Kriegsjahre zu überbrücken.
Henry Rasmussens Liebe aber blieb der Regattasport, und es fuchste ihn, wenn die besten von ihm gebauten Yachten nicht auch den besten Steuermann hatten, also ihn. Zur Kieler Woche 1914, in den Tagen, die dem Beginn des Ersten Weltkrieges vorangingen, beobachtete er den verpatzten Start der nagelneuen 12-Meter-R-Yacht „Skeaf“ die kürzlich an den Schleswiger Reeder Henry Horn ausgeliefert worden war. Er schimpfte über den „Nachtwächter“, der dort an der Pinne saß.
Der Nachtwächter war der Eigner selbst. Der lud ihn ein, sich selbst mal ans Ruder zu setzen, worauf Henry Rasmussen am nächsten Tag einen Sekundenstart hinlegte und einen glänzenden Kieler-Woche-Sieg errang. Reeder Horn wurde einer der treuesten Kunden von A&R.
Die Rolle der Starboote
In den wirtschaftlich schwierigen Nachkriegsjahren blieben größere Aufträge zunächst aus. Für den Nachwuchs des Weser Yacht Clubs baute die Werft 1919 zwei einfache offene Kielboote einer Einheitsklasse, die 1911 in den USA als „Starboot“ entstanden war. Die „Onkel August“ und „Max Tille“ von A&R waren die ersten in Europa gebauten Stare.
In Deutschland taten sich die Segler mit diesen kantigen Kisten zunächst recht schwer. Zu hässlich, hieß es. Rasmussen aber geschah das Glück, einen Mann an seine Seite zu bekommen, der mit seiner Segelbegeisterung fast den Bankrott des eigenen Unternehmens in Kauf nahm. Erich F. Laeisz, Reeder der Flying-P-Liner, der letzten großen Frachtsegler, setzte sich vehement für die neue Klasse ein.
Skandinavische Lösung und neue Partnerschaften
Geschäftlich lief es in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland eher mau. Rasmussen entschloss sich daher, eine Reise nach Skandinavien zu unternehmen. Dort gelang es ihm, eine Reihe von Aufträgen für Schärenkreuzer zu akquirieren und so die schwierige Zeit zu überbrücken, bis zu Hause wieder an Segeln zu denken war.
„Ich war überall unterwegs, da ich auf allen Regattaplätzen sein musste, um an Freud und Leid teilzunehmen“, schrieb er in seiner Autobiografie.
Seinem Partner Georg Abeking aber fehlte die Zuversicht, die Werft in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten noch einmal auf die Überholspur zu bringen. Im Jahr 1925 verließ er das Unternehmen.
Um Abeking auszuzahlen, musste Rasmussen das Wertvollste verkaufen, das die Werft besaß: das Holzlager. Und er brauchte einen neuen Partner. Den fand er in dem pensionierten Konteradmiral Edmund Schulz. Rasmussen: „Der Admiral war zwar ein zäher Arbeiter, aber kein Diplomat. Er besaß die fabelhafte Eigenschaft, sich bei allen Menschen, ganz gleich ob Kunde oder Lieferant, unbeliebt zu machen. Die Partnerschaft hat mich 100.000 Goldmark gekostet, aber ich war froh, dass ich ihn 1931 los war, und jeder in der Firma hat aufgeatmet.“
Erneute Aufträge aus den USA
Die Zeit der fehlenden Aufträge nutzte der Werftchef für den Bau eines eigenen Schiffes. Am 28. Juni 1924 ging der stählerne, als Ketsch getakelte 26-Tonnen-Tourenkreuzer „AR“ zu Wasser. Vier Tage später war Rasmussen mit Bootsmann und Familie bereits auf dem Weg in die Ostsee, wo er zunächst seine alte Heimat am Svendborgsund besuchte. Hier befand sich gerade der dänische König Christian X. an Bord seiner Staatsyacht „Danebrog“. Er stattete der „AR“, die die dänische Flagge trug, einen kurzen Besuch ab.
1936 baute sich der Werftchef eine weitere „AR“, einen 19 Meter langen 125er Seefahrtkreuzer, Lärche auf Stahl- und Eichenspanten. Über einige Umwege gelangte die Yacht 1981 in die Hände des Fotografen Tom Nitsch, der die Yacht am Svendborgsund überholen ließ. Heute gehört die „AR“ mit ihren wunderbaren Linien zu den am besten restaurierten Klassikern in Deutschland.
Ab 1924 ging eine größere Anzahl von Aufträgen aus den USA ein, Ergebnis des guten Rufes von A&R in Übersee, aber auch der günstigen Wechselkurse. Die Boote wurden in Dollar bezahlt.
Der Einfluss amerikanischer Kunden
Ein Syndikat New Yorker Segler bestellte gleich 14 identische, von dem Stararchitekten Starling Burgess gezeichnete 10-Meter-R-Yachten. Die saftige US-Einfuhrsteuer konnte umgangen werden, wenn die Boote auf eigenem Kiel amerikanische Häfen ansteuerten. So verschiffte Henry Rasmussen alle 14 Yachten in den kanadischen Hafen Halifax. Dort stellte man einen Konvoi zusammen, der die letzten 500 Seemeilen zum Long Island Sound zurücklegen sollte. unter den Überführungscrews befand sich ein 17-jähriger Segler mit Namen Olin Stephens, der mit seinem Design büro Sparkmann & Stephens (S&S) nicht nur der erfolgreichste Konstrukteur der Welt werden sollte, sondern auch ein bedeutender Kunde der Werft.
Rasmussen wurde bei den Oligarchen der US-Ostküste herumgereicht. Er war zu Gast auf Landsitzen und auf Privatyachten so groß wie Ozeandampfer und besuchte staunend die Werft von Nat Herreshoff. Er schrieb: „Seine Yachten sind die schönsten hier, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen.“
Die Reise brachte weitere Aufträge für die Werft an der Weser. Allein die damals führenden Yachtkonstrukteure Burgess & Morgan bestellten 61 Boote der Atlantic-Klasse für die USA und reisten mit Sonderzügen nach Hamburg, um die Neubauten auf einem Autotransporter über den Atlantik zu bringen.
Der plötzliche Einfuhrzoll
Jimmy, der diesen Spitznamen wohl in den USA erhielt, gelang noch ein doppelter Coup: Die wichtigste Regattaklasse in den USA waren in den 1920er Jahren die Sechs-Meter-R-Yachten, in Deutschland waren es hingegen die Schärenkreuzer. Auf Rechnung seines Freundes Erich F. Laiesz baute A&R zwei Sechser und lag damit richtig. Denn 1928 wurde der Sechser Olympiaklasse, und die neue „Pan“ von Laeisz ging vor Amsterdam an den Start.
Umgekehrt gelang es, eine Flotte von A&R-Schärenkreuzern zu Vergleichsregatten mit den Sechsern an die US-Ostküste zu bringen. Die Amerikaner waren begeistert, eine Flut von Aufträgen sorgte für Vollbeschäftigung in Lemwerder.
Zu dieser Zeit hätte die Werft ausschließlich von Aufträgen aus den USA leben können. Leider setzten die Amerikaner plötzlich eine verschärfte Einfuhrsteuer von nunmehr 30 Prozent durch, egal ob die Boote auf eigenem Kiel anreisten oder nicht.
Henry Rasmussen war außer sich und bat sogar den Autobauer Henry Ford, seinen Einfluss geltend zu machen. Umsonst. Es kam wie erwartet: Die Aufträge der Freunde aus Amerika blieben schlagartig aus. Yachten aus Deutschland waren zu teuer geworden. Rasmussen plante daher, in New York eine Zweigstelle der A&R-Werft aufzubauen. Der Mangel an ausgebildeten Arbeitskräften vereitelte den Plan.
Rückkehr des deutschen Marktes
Glücklicherweise zog die Nachfrage aus Deutschland Anfang der 1930er Jahre wieder an.
Ab 1936 erhielten alle Neubauten der Werft eine vergoldete Ziergöhl. Der Hamburger Walter von Hütschler gewann 1936 und 1937 die Weltmeisterschaft in einem A&R-Starboot. Die Werft konnte kaum die Nachfragen aus aller Welt bewältigen.
Als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, mussten alle Werftkapazitäten der Kriegsmarine zur Verfügung gestellt werden. A&R war nun vornehmlich mit der Herstellung von Minenräumbooten beschäftigt. Im besetzten Dänemark, Rasmussens Heimat, ergab sich für ihn die Gelegenheit, eine kleine Yachtwerft zu erwerben. Hier arbeiteten zeitweilig 100 Bootsbauer. Bei Kriegsende wurde die Werft zwangsenteignet. Bei dem verständlichen Hass, der durch die Besetzung Dänemarks gegen alles Deutsche bestand, durfte Rasmussen froh sein, dass er nicht im Gefängnis landete. Im Grunde wohl ein unpolitischer Mensch – Parteigenosse war er jedenfalls nicht –, hinterließ das Verhalten seiner Landsleute bei ihm eine tiefe Bitterkeit.
Wiederaufbau und Erneuerung
Die Werft in Lemwerder war weitgehend erhalten geblieben. Zum Neuanfang baute Rasmussen vor allem Jollen, darunter die von ihm entwickelte gedeckte Hansa-Jolle, die sich gut verkaufen ließ, weil sie wegen ihrer geringen Größe nicht unter das von den Alliierten verfügte Segelverbot fiel.
Und wiederum waren es die Amerikaner, die A&R weiterhalfen. Der günstige Wechselkurs und der Ruf von A&R brachten der Werft ab den 1950er Jahren Aufträge für immer größere Yachten, viele davon nach Rissen von Olin Stephens gebaut. Die Krönung aber war der Bau von 99 Concordia Yawls, einem besonders gelungenen Riss von 12 Meter Länge von C. Raymond Hunt. Die in A&R-Qualität gebauten Concordia Yawls zementierten den legendären Ruf von Rasmussens Werft in den USA weit über den Tod des Werftchefs hinaus.
Ein neues Wirtschaftswunder
Das Wirtschaftswunder brachte auch wieder Großaufträge aus Deutschland. Hans-Otto Schümann, der Doyen der deutschen Hochseesegler, ließ sich 1951 seine erste „Rubin“ bauen, 11 KR nach der neuen Vermessungsformel. Alfred Krupp bestellte sich seine vierte „Germania“, eine 13-KR-Yawl aus Stahl, Riss von S&S.
Der Werftchef selbst segelte 1951 seine neue 8 KR „Hera“, „ein sehr schönes, handiges und seetüchtiges Schiff“, nach Ostschweden. Bereits im folgenden Jahr entstand eine weitere „Hera“, ein Motorsegler von 16,60 Meter Länge, 1955 in Fahrt gekommen. Es ging zur Kieler Woche, nach Sandhamn zum 125. Jubiläum des Königlich Schwedischen Yacht-Clubs, durch den Göta-Kanal nach Svendborg und zurück nach Lemwerder. In seiner Autobiografie notierte der Meister: „Die zurückgelegte Strecke beträgt 1.755 Seemeilen. Das schöne Wetter hat uns keinen Tag im Stich gelassen. Ich glaube sagen zu dürfen, dass diese Reise 1955 zu den schönsten Reisen meines Lebens gehört.“
Am 2. Juni 1959 starb Henry Rasmussen in Bremen an den Folgen eines Autounfalls. Sein Sohn Hermann Schaedla und sein Enkel Hans Schaedla bewahrten das Erbe. Bis heute genießt Abeking & Rasmussen einen hervorragenden Ruf. Auch wenn die Schiffe, die dort heute gebaut werden, in der Größe an die großherzogliche Staatsyacht „Lensahn“ erinnern – geblieben ist die Liebe zum Holz. Zur Ausbildung bei A&R gehört noch heute der Bau einer Jolle aus Holz. Ganz im Sinne des großen Namensgebers der Werft.

