Porträt: Walter Meier-Kothe ist ein Händler fortgeschrittener Segelträume

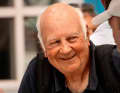




- In der Gründungsphase liefen die Schiffe unter dem Namen “C&C Yachts”
- Der erste Luxus-Sandwich-Bau von Baltic brummte bei der Probefahrt ohne Schaden auf Grund
- 1978 trennt sich Baltic Yachts von C&C und ernennt Walter zum offiziellen Vertreter
- Auch als Segler blieb Walter Meier-Kothe erfolgreich
- Freund Hasso Plattner ist einer seiner besten Kunden
- Bis heute gilt die „Visione“ als echte Ikone unter den Maxi-Yachten
- Zwölf Jahre lang schipperte Meier-Kothe auf der Baltic 50 „Espada“ im Mittelmeer herum
Es gibt in Deutschland Segelhelden, die von der Vermarktung ihres Ruhmes leben. Die kennt jeder. Und es gibt Segler, die als Strippenzieher dezent im Hintergrund des Yachtsports ihr Geld verdienen. Die sind weniger bekannt, denn Diskretion gehört zu ihrer Geschäftsgrundlage. Zu Letzteren gehört Walter Meier-Kothe, 80, der seit einem halben Jahrhundert die finnische Werft Baltic Yachts im deutschsprachigen Raum vertritt.
Baltic Yachts baut seit seiner Gründung vor 51 Jahren High-Performance-Segelyachten. Zunächst in der Größenordnung von zehn bis 15 Meter und heute bis zu rekordverdächtigen 67 Meter Länge. Versteht sich, dass man es in diesem Geschäft nicht nur mit großen Schiffen, sondern auch mit großen Egos und noch größeren Träumen zu tun hat.
Walter Meier-Kothe, geboren im polnischen Lodz, wuchs in Bremen auf. Als Jugendlicher erkundete er die Welt zunächst im Faltboot, dann als Leistungssportler im olympischen Renn-Kajak. Neben seiner kaufmännischen Ausbildung in der väterlichen Spedition gewann er zwei Deutsche Meisterschaften und begann hochwertige Renn-Kajaks und Canadier aus Dänemark zu vertreiben. Als der Vater den Betrieb einstellte, wurde Walters Nebenjob zum Beruf.
Inzwischen nach Hamburg umgezogen, teilte er sich sein Trainingsrevier, die Alster, mit den Seglern. Dort mietete er sich an einem trainingsfreien Tag eine Jolle – und entdeckte den Segelsport. Er lernte schnell. Während der Nordseewoche 1973 vor Helgoland gehörte der Kanu-Meister schon zur Crew der Swan 43 „Rebecca“. Das war eine richtige Hochseeyacht. Auf der Nordsee traf er diesen tollkühnen Fotografen Peter Neumann, der mit einem kleinen Motorboot durch die himmelhohe See bretterte, um Yachten hautnah zu fotografieren.
Auch interessant:
Neumann residierte mit seinem gerade gegründeten Yacht Photo Service (YPS) in der legendären Hamburger Villa Elbchaussee 189 als Mitglied einer Kommune wilder Segler, die vor Ideen nur so sprühten und gerade dabei waren, die traditionelle Hochsee-Regattaszene zu rocken. Höchst unkonventionelle Hippies trafen dort auf sportlich erfolgshungrigen hanseatischen Segeladel. Es war die perfekte Zeit, um im Yachtsport Karriere zu machen.
In der Gründungsphase liefen die Schiffe unter dem Namen “C&C Yachts”
Walter Meier-Kothe suchte das YPS-Office auf, um einige Fotos als Erinnerung für den Eigner der „Rebecca“ an seinen Helgoland-Törn zu besorgen. Weil das Büro an der vornehmen Elbchaussee lag, trug er Blazer mit Krawatte. So etwas hatte man in der Villa lange nicht gesehen. Dort lernte er zwei Mitbewohner kennen, die bald Karriere machen sollten und zu seinen Freunden und Geschäftspartnern wurden: Rolf Vrolijk, einen in Hamburg gestrandeten Jollensegler aus Holland, der als Konstrukteur der „Alinghi“ 2003 und 2007 den America’s Cup für die Schweiz gewann, und Michael Schmidt, der 1990 Hanseyachts gründete und zu einer der größten Bootsfabriken Europas entwickelte.
Wie Walter so schick in Schlips und Kragen vor den beiden stand, sagte Schmidt in seiner direkten Art: „In Finnland haben sie gerade eine Werft gegründet. So, wie du aussiehst, kannst du den reichen Leuten Boote verkaufen.“ Das fand Walter auch. Und so begann die Sache mit Baltic Yachts.
In der Gründungsphase, 1973, vermarktete Baltic Yachts seine Schiffe zunächst unter dem Namen C&C Yachts. Zum einen, weil die finnische Werft noch völlig unbekannt war und der gut eingeführte Name C&C ein Marketing-Vehikel darstellte. Zum anderen lieferte das Cuthbertson & Cassian Design Office, besetzt mit international renommierten Yachtkonstrukteuren, den Finnen für ihr Startup revolutionäre Konstruktionen mit allen Unterlagen bis hin zu Stücklisten.
Baltic-Yachten bestachen daher von Anfang an nicht nur durch bestes Styling, sondern setzten mit ihrer innovativen Sandwich-Technologie neue Standards im Bootsbau. Rumpf und Deck entstanden nicht in der herkömmlichen GFK-Bau-weise. Die Verwendung von Glasfasermatten mit optimierter Struktur (unidirectional rovings), die einem Sandwich gleich einen Kern aus leichtem Balsaholz umschlossen, ermöglichte eine leichtere, steifere und besser isolierte Bauweise. Längst ist das Sandwich-Prinzip beim Bau hochwertiger Yachten Standard, wenn auch mit verbesserten Materialien.
Der erste Luxus-Sandwich-Bau von Baltic brummte bei der Probefahrt ohne Schaden auf Grund
Im Herbst 1974 kreuzte die erste von Baltic nach diesem Verfahren gebaute C&C 46, „Diva“, zunächst bei der Hamburger Bootsausstellung auf, dann auf der Kieler Förde. Mit einer Länge von 14 Metern galt sie damals als großes Schiff. Der norwegische Eigner wünschte für die Heimreise ein paar Kilo Kaviar an Bord, was Walter gleich einen Eindruck von der Klientel verschaffte, mit der es fortan zu tun bekam.
Der erste, wegen des ungewöhnlichen Balsaholz-Kerns kritisch beäugte Luxus-Sandwich-Bau von Baltic brummte bei der Probefahrt auf Grund. Kein Schaden. In der nächsten Saison qualifizierte sich „Diva“ für das norwegische Admiral’s-Cup-Team. 2023 in Finnland grundüberholt, kreuzt die C&C 46 ein halbes Jahrhundert nach ihrem Stapellauf noch immer durch Norwegens Fjorde.
Mit der „Diva“ setzte Baltic ein Ausrufungszeichen in der Yachtszene. Sie verband Komfort mit überragenden Segeleigenschaften in einer Zeit, in der immer mehr Eigner das Regattasegeln für sich entdeckten und der Begriff Cruiser/Racer entstand. Da lagen die Finnen weit vorn.
Einem aktiven Regattasegler wie Walter Meier-Kothe war das nur recht. Sein Geschäft als Vertreter der Werft nahm Fahrt auf. Ende 1974 besuchte er die Werft am Polarkreis zum ersten Mal. Dort entstand gerade ein radikaler 12,60-Meter-Racer, die „Tina I-Punkt“, für den innovationsfreudigen Hamburger Thomas Friese. Das Design des pechschwarzen Schiffes – keine Inneneinrichtung, kein Decksaufbau, enorme Segelfläche, Pinne statt Steuerrad – hatte C&C geliefert, war aber von Rolf Vrolijk modifiziert worden.
1978 trennt sich Baltic Yachts von C&C und ernennt Walter zum offiziellen Vertreter
Die erste Saison dieses Prototyps bescherte „Tina I-Punkt“ den Gesamtsieg in der stürmischen 500-Seemeilen-Skagen-Regatta von Helgoland nach Kiel. Baltic nutzte die Erfahrungen mit der „Tina I-Punkt“ und baute eine Reihe von gleich großen, aber deutlich komfortableren Yachten, die als C&C 42 angeboten wurden. Walter verkaufte – und ließ selbst kaum eine Regatta aus. Zusammen mit Schmidt und Vrolijk trat man den Beweis an, dass ein besser gebautes Schiff auch schneller segelt.
Ende 1975 kam bei C&C in Kanada die Idee auf, den Umsatz der Hamburger Filiale durch eine eigene Produktion kleinerer Schiffe in Deutschland auszuweiten. Michael Schmidt, Rolf Vrolijk und Walter setzten diese Idee in Rekordzeit um. Mit dem bekannten Kieler Architekten Herbert Weidling wurde in Kiel-Wellsee eine Werft aus dem Boden gestampft.
Bereits im Frühjahr 1977 lief der erste von Walter verkaufte Halbtonner C&C 30, „Lepanto“, vom Stapel. OK-Jollen-Weltmeister Thomas Jungblut wurde von Walter an Bord geholt und startete so seine Seesegel-Karriere. Die Saison beendete er als zweitbester Halbtonner, und es gelang Walter, 30 dieser Schiffe im ersten Jahr zu verkaufen. Das entsprach in etwa einem Drittel des deutschen Marktes in dieser umkämpften Bootsgröße. Auf der Hamburger Bootsausstellung im Herbst erleichterte Walter dann den Architekten Weidling um einen guten Teil seines Honorars, indem er ihm die erste Baltic 39 verkaufte. 1978 trennte sich Baltic Yachts von C&C und ernannte Walter zum offiziellen Vertreter für den deutschsprachigen Raum, auf Provisionsbasis, wie gewünscht. Es war die richtige Entscheidung, wie Walter bestätigt: „Mein Beruf ist mein Hobby. Ich kann so viel segeln, wie ich will. Besser geht’s nicht.“
Auch als Segler blieb Walter Meier-Kothe erfolgreich
Was ist das Geheimnis seines Erfolges? „Ich bin überall dabei. Viele Kunden haben mich als Segler kennengelernt, also als einen von ihnen. Das schafft Vertrauen. Auch umgekehrt. Ich habe schnell ein Bauchgefühl dafür entwickelt, ob ein Kunde seriös und wirklich interessiert ist. Vor allem bin ich bei Problemen immer auf die Eigner zugegangen und habe mich nie weggeduckt. Ende der neunziger Jahre zog sich Baltic Yachts aus dem Serien-Yachtbau zurück und entschied sich für den Einzelbau. Daher wurden mit der Zeit die Projekte immer komplexer, und es sitzen Leute mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen am Tisch. Meine Stärke ist es dann, zu moderieren und Lösungen zu finden.“
Auch als Segler blieb Walter Meier-Kothe erfolgreich. 2000 stellte er als Skipper der 20-Meter-Baltic 67 „Uca“ einen bis heute bestehenden Rekord in der Skagen-Regatta auf: 43 Stunden, 46 Minuten von Helgoland bis Leuchtturm Kiel. „In der Jammerbucht haben wir unter Spinnaker ein Containerschiff überholt. Top-Speed im Surf 26 Knoten“, erinnert er sich.
Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt seines Seglerlebens, das ihn meist auf Baltic-Rennyachten zu fast allen internationalen Regattaplätzen zwischen Hawaii und dem Mittelmeer führte. Walter überstand unbeschadet die „Todes-Regatta“, das Fastnet-Race von 1979. Ganz anders das Fastnet-Rennen 1997: Bei seiner fünften Teilnahme gewann er mit der Maxi-Yacht „Morning Glory“ seines Kunden Hasso Plattner über alle Klassen.
Mit seiner eigenen Zwölf-Meter-Judel/Vrolijk „Espada“ (dt. Schwertfisch), die er auf Michael Schmidts Yachtwerft Wedel als Schwesterschiff zur innovativen „Düsselboot“ gebaut hatte, verpasste er 1981 nur knapp die Teilnahme am Admiral’s Cup. Mit diesem Schiff gehörte er beim Sardinia’s Cup 1982 zum deutschen Team und 1983 beim Admiral’s Cup zum Team Österreich. Mit der nächsten „Espada“, der Baltic 39 mit der Baunummer 13, die er einem ehemaligen Kunden abkaufte, segelt er heute noch.
Freund Hasso Plattner ist einer seiner besten Kunden
Als Händler für fortgeschrittene Segelträume lebt Walter mit seiner aus der Schweiz stammenden Frau Sabine („Ich habe ihr das Segeln beigebracht, sie mir das Skifahren“) am Olympiazentrum Kiel-Schilksee, mit Panorama-Blick über die Förde. Der Mann, der einem dort gegenübersitzt, strahlt mit seinem stets etwas verschmitztem Lächeln vor allem Optimismus und Vertrauenswürdigkeit aus. Ganz eindeutig, den Mann hat eine glückliche Kindheit geformt, und er hat schon längst seine Mitte gefunden. Keine schlechte Voraussetzung, wenn Kunden oftmals mit zweistelligen Millionenaufträgen an seine Tür klopfen. Und viele klopften nicht nur einmal, sondern nach ein paar Jahren wieder an seine Tür.
Was erlebt man so alles in der Mega-Welt? Diskretion Ehrensache, aber das ein oder andere erfährt man schon. Schließlich befinden wir uns unter Seglern, da darf man sich mal einen Schnack erlauben. Hier ist so einer: Sein gleichaltriger Freund Hasso Plattner, Gründer des SAP-Software-Hauses und als Regattasegler mit allen Wassern gewaschen, ist einer seiner besten Kunden. 1988 bat er Walter, ihm einen IOR-Eintonner aus zweiter Hand zu besorgen, eine Zwölf-Meter-Rennyacht für den großen Sport. Albert Büll, auch ein Baltic-Kunde, bot seinen Eintonner „Saudade“ an. Die sollte aber genau doppelt so viel kosten, wie Walter als Fachmann veranschlagt hatte. Verhandeln unmöglich.
Plattner war mit dem hohen Preis trotzdem einverstanden, unter der Bedingung, dass Büll die Hälfte in den Kauf von SAP-Aktien investiert. Das in dem Jahr, als SAP an die Börse ging. Beide Parteien waren zufrieden. Plattner, weil er zu einem guten Eintonner kam, der später als „Abab“ erfolgreich war. Büll, weil sich SAP bis heute zum wertvollsten Unternehmen im Deutschen Aktienindex entwickelte.
Bis heute gilt die „Visione“ als echte Ikone unter den Maxi-Yachten
Hasso Plattner war es auch, der zur Jahrtausendwende zu neuen Dimensionen im Bootsbau aufbrach. Mit Walter als Projektleiter, zusammen mit Baltics Håkan Björkström, gab er eine Yacht in Auftrag, die bei wohnlicher Inneneinrichtung kompatibel sein sollte, den Maxi Rolex World Cup zu gewinnen.
2002 war die „Visione“ fertig, eine Orgie in Carbon und Titan, 44,8 Meter lang, nur 105 Tonnen schwer, davon 50 Tonnen im Kiel. „Deck- und Rigg-Ausrüstung mussten wegen der Dimensionen speziell angefertigt werden. Die verfügbaren Fallscheiben für den Mast waren so groß und schwer wie Räder von Eisenbahn-Loren. Da habe ich Peter Harken überredet, für diese Lasten endlich eine Hightech-Lösung zu entwickeln. Heute ist die Standard“, erinnert sich der Projektleiter. Bis heute gilt die „Visione“ als echte Ikone unter den Maxi-Yachten.
Zehn Jahre später folgte mit der 66 Meter langen Carbon-Ketsch „Hetairos“ für den Deutsch-Schweizer Otto Happel ein Format, das, wo immer es auftaucht, mit seinem klassischen Rumpf und seinen zwei gleich hohen Masten bewundernde Blicke auf sich zieht.
1996 erhielt Walter Meier-Kothe den Anruf einer Dame, die sich nach einem „größeren Segelboot“ für ihren Chef erkundigte. Wie groß das Boot sein sollte, wusste sie nicht, und sie hielt sich auch sonst bedeckt. Walter versuchte es anders: „Wenn Ihr Chef ein Haus in Hamburg kaufen würde, wo würde er das haben wollen?“ Die Antwort war: „In Blankenese.“
Das schien seriös zu sein. Der „Chef“ entpuppte sich später als Hans-Georg Näder, geschäftsführender Gesellschafter der Otto-Bock-Gruppe in Duderstadt, Weltmarktführer in der Fertigung von Prothesen.
Zwölf Jahre lang schipperte Meier-Kothe auf der Baltic 50 „Espada“ im Mittelmeer herum
Näder lud Walter und Baltic-Werftchef P. G. Johansson auf seine 18-Meter-Yacht „Pink Gin“ nach Porto Cervo ein, um über einen Neubau zu sprechen. Nach der Besichtigung überraschte Näder Walter mit dem Wunsch, er möge die Yacht aus dem Hafen bringen, Segel setzen und ein Stück an der Kreuz segeln. Als das problemlos gelungen war, wurde P. G. gebeten, das Ruder zu übernehmen und „Pink Gin“ vor dem Luxushotel „Romazzino“ an die Tonne zu legen. P. G.s Frage, ob unter Segel oder Motor, wurde beschwichtigend mit „unter Motor“ beschieden. Test bestanden.
„Immer im richtigen Moment die Nerven behalten“, blickt Walter Meier-Kothe zurück. Der neu gewonnene Kunde bestellte bei Baltic Yachts bis heute drei Yachten, 29 Meter, 46 Meter und 60 Meter lang. Darüber hinaus orderte er ein 17-Meter-Cantingkielboot mit besonders rassigem Styling. Näders Hauskonstrukteur wurde Rolf Vrolijk, welcher der Elbchaussee-Kommune schon längst entwachsen war.
Hans Georg Näder griff später der Baltic-Werft, die sich im Besitz der Belegschaft befand, finanziell unter die Arme, als – ausgelöst durch die Finanzkrise – die Banken keine Anzahlungsgarantien mehr geben wollten und so zwei Großaufträge nicht zum Abschluss gebracht werden konnten. Heute hält er 80 Prozent der Anteile. Die Auftragslage ist hervorragend.
Für Walter ein Grund, sich mit 80 Jahren zur Ruhe zu setzen und es mit dem Segeln ruhiger angehen zu lassen? Aber nein. Zwölf Jahre lang schipperte er mit seiner Frau auf der Baltic 50 „Espada“ im Mittelmeer herum. 2020 hat er diese Yacht verkauft. Geblieben ist die Baltic 39.
Heute liegt die alte Dame in Sichtweite im Olympiahafen Schilksee. Die meisten Arbeiten an Bord erledigt er selbst. Aber die berufliche Pflicht ruft immer noch. Ein Hamburger Eigner hat gerade eine 24-Meter-Baltic übernommen. Beim Maxi Rolex Cup im September vor Sardinien wird er seine Kontakte pflegen, auch zu den beiden neuen Kunden, die dort mit ihren umweltoptimierten 21 Meter langen Baltic 68 Café Racern aufkreuzen.
Mit der „Raven“, einem 24-Meter-Cruiser-Racer auf Foils, hat Baltic die Tür zu einer neuen Dimension geöffnet. Wer denkt da schon ans Alter? Walters Mutter hat sich noch im Alter von 104 Jahren täglich ihre Zeitung am Kiosk besorgt.

