





Ich lag mit meinem Boot im Hafen und dachte über den Segeltörn nach, den ich hinter mir hatte. Drei Monate lang nur ich, meine Gedanken und mein Boot und das Meer. Es war genauso gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Im Büro hatten sie meine Segeltour ein Sabbatical genannt. Ich war schon fünfzehn Jahre dort angestellt und merkte, dass meine Kollegen immer jünger wurden. Ich selbst wurde immer älter. Entgegen meinen ursprünglichen Hoffnungen war ich nie befördert worden. Eine Zeit lang hatte ich mich damit schwergetan, dann hatte es mich nicht mehr interessiert. Die Zeit der Ambitionen schien abgelaufen.
Eines Nachmittags bestellte mich der Personalleiter zu sich. Er schlug mir ein Sabbatical vor. Drei Monate, bei voller Bezahlung. Die Neuigkeit sprach sich schnell herum. Alle wussten sie, dass ich schon seit Jahren von einem Segeltörn träumte; ich hatte oft und ausführlich davon erzählt. »Auf geht’s«, sagten meine Kollegen. »Du hast es dir verdient, nach fünfzehn Jahren. Vielleicht blühst du dabei richtig auf. Eine Weile raus aus allem.«
Start ins Sabbatical
»Mach es ruhig«, sagte auch Hagar. »Du wünschst es dir doch schon so lange. Ich komme schon zurecht. Es wird ja auch schön ruhig hier, wenn du nicht da bist. Seit ich dich kenne, redest du von einem Segeltörn. Jetzt ist der richtige Moment dafür.«
Ich segelte die Küste von England hinunter, vorbei an Irland, vorbei an Schottland, über die Shetlands hinweg nach Aberdeen. Eine Perlenkette von Inseln und Felsen und Stränden entlang. Es war Sommer, aber auch im Sommer waren die Wellen steil und hoch. Daran kann man sich gewöhnen, und ich gewöhnte mich schnell daran.
»Maria war alt genug, um mit nach Hause zu segeln. Wir haben sie schon von Geburt an zum Segeln mitgenommen.«
Das Boot schloss Freundschaft mit dem Meer. Manchmal kam es mir vor, als wären beide ein Teil von mir geworden. Ich freundete mich zunehmend mit dem Alleinsein an. Die Nächte, die Lichter, die kalten Stunden zwischen zwölf und vier Uhr nachts. Die Hundewache. Die Ankerbuchten, in denen kein anderes Schiff sich blicken ließ. Die Gespräche, die ich mit mir selbst und meinem Boot führte. Den Rest meines Lebens verlor ich immer mehr aus dem Blick. Zuerst das Büro. Vor allem das Büro und alles, was dort wichtig war.
Highlight zum Abschluss der Reise
Maria ist meine Tochter und mein einziges Kind. Sie ist sieben. Erst wenn sie acht wird, werde ich merken, wie klein ein Mädchen von sieben Jahren eigentlich wirklich ist. Mütter wollen nicht, dass ihre Kinder älter werden, Väter schon. Väter können es kaum erwarten, dass ihre Kinder endlich groß genug sind, um Väterdinge mit ihnen zu unternehmen. Und Maria war alt genug, um mit mir zusammen von Thyborøn nach Hause zu segeln. Darauf hatte ich mich mit Hagar geeinigt.
Wir haben Maria schon von Geburt an zum Segeln mitgenommen. Sie ist gewöhnt an den Lärm der Wellen und des Windes, daran, dass sich das Boot unter den Füßen bewegt wie ein Fahrgerät auf dem Jahrmarkt. Maria liebt es, beim Segeln nach vorn zu schauen, über das Deck hinaus. Manchmal setzt sie sich in den Bugkorb an der Spitze des Boots und lässt sich hin und her wiegen, bis sie dann fast einschläft. Maria kann die Segel setzen und wieder einholen. Sie steht auch gern an der Pinne. Das alles habe ich ihr selbst beigebracht. Einmal hat sie sogar in einem Hafen angelegt. Sie war jetzt alt genug. Ich konnte mich auf sie verlassen.
Crew aus Tochter und Vater
Es ging los. Das Boot war abfahrbereit. Die See hatte den Sturm abgeschüttelt. Die Wellen hatten keine Schaumkronen mehr, sondern rollten gemächlich auf den Strand zu. Stolz lief ich mit meiner Tochter über das Deck. Ich hatte meinen gelben Segelanzug angezogen, Maria trug eine blaue Regenhose. Sie sah prächtig aus, mit ihren hellen Augen. »Ist es sehr weit?«, fragte sie. »Nein, es geht so«, sagte ich.
Drei Monate lang hatte ich versucht, auf See zur Ruhe zu kommen. Es war mir nicht besonders gut gelungen. Die Leute, denen ich unterwegs begegnet war, hatten mich an die Kollegen im Büro erinnert. Jeder Hafen, jede Insel war voller Menschen. Es gab kein Entkommen. Und zudem näherte ich mich mit jeder Seemeile, die ich zurücklegte, wieder der Welt, der ich entflohen war. Ich spürte, wie ich immer schwermütiger wurde. Bis zu dem Augenblick, als meine Tochter vor mir stand. Meine Tochter, die mich liebte.
»Drei Monate lang hatte ich versucht, auf See zur Ruhe zu kommen. Es war mir nicht besonders gut gelungen. Bis zu dem Augenblick, als meine Tochter vor mir stand. Meine Tochter, die mich liebte.«
Auch andere Yachten legten jetzt ab. Das Hafenbecken leerte sich allmählich. Ich ließ den Motor an. Immer wenn ich den Motor anließ, spürte ich am ganzen Körper ein Prickeln. Als wäre ich gerade aus der Sauna gekommen und in ein Bad mit eiskaltem Wasser gesprungen. »Maria!«, rief ich. »Wir sind so weit, wir stechen in See. Hilfst du mir mit den Leinen?« Sie kam aus der Kajüte und lief aufs Vorschiff. Sie trug eine grellgelbe Rettungsweste. »Du musst auch eine Rettungsweste anziehen«, sagte sie. »Wenn ich eine anziehen muss, musst du auch.«
Vorsichtig holte sie die Leinen ein, mit denen das Boot am Steg festgemacht war. Ich sah ihr zu. Sie schoss die Leinen in ordentliche Buchten auf, gründlich und konzentriert. Thyborøn wurde immer kleiner. Erst sah es aus wie eine Stadt aus Lego, dann sackten die Häuser hinter den Horizont, nur die Schornsteine und die Windräder auf ihren langen Masten waren noch zu sehen.
Raus aufs Meer
Ich wollte weit aufs Meer hinaus, so weit wie möglich. Ich wollte kein Land mehr sehen. In Küstennähe war die See manchmal am bösartigsten. Dort gab es Sandbänke, die nicht auf der Karte eingezeichnet waren. Und vor der Küste fuhren Fischer, die auf ein kleines Segelboot keine Rücksicht nahmen. Weiter draußen konnte uns nichts passieren. Wenn Sturm aufkam, würde das Boot ein bisschen auf den Wellen tanzen, bis er sich wieder gelegt hätte. Auf dem Meer wäre uns nichts mehr im Weg. Je weiter weg, desto sicherer.
Ich setzte die Segel, Maria stellte den Motor ab, und dann hörten wir nur noch die See an den Bordwänden rauschen. Wir hatten mehr als nur das Festland hinter uns gelassen. Je weiter wir hinausfuhren, desto mehr wurde die Welt die unsrige. Wir hörten nur noch die Geräusche, die von unserem eigenen Boot stammten, vom Wasser, vom Wind und von einem vereinzelten Vogel, der bei uns vorbeischaute. Die Geräusche hatten einen Rhythmus. Wir hörten das Knarren der Kajüte. Den Wind im Achterstag. Das Flattern der niederländischen Flagge am Heck. Das Boot wiegte sich im Wellengang. Seekrank werden konnte man davon nicht. Wir segelten, bis wir kein Land mehr sahen. Bis die See ein großer Kreis geworden war und wir der Mittelpunkt. Maria saß in der Kajüte. Sie zeichnete. Der Autopilot lenkte das Boot. Ich hatte ihn auf einen Kurs von 230 Grad eingestellt, und er wich nicht um ein Grad davon ab.
Plötzliches Verschwinden
Hundewache. Ein Uhr nachts. Die Sonne war mit einem Karneval an Farben hinter dem Horizont versunken, und seitdem war alles schwarz-weiß. Am Himmel stand ein heller Mond. Ich hatte Maria in die Koje gebracht. Sie war sofort eingeschlafen. Ich saß mit dem Rücken zur Reling und trank Kaffee aus einer Thermoskanne. Ich hatte gleich zwei Flaschen gefüllt: eine mit Kaffee und eine mit Tee. Auch Essen hatte ich dabei, damit ich während der Hundewache nicht noch mal nach drinnen musste, um etwas zu holen. Maria sollte in Ruhe schlafen können. Nicht von meinem Gepolter aufwachen.
Alle zehn Minuten schaute ich einmal um mich. An Steuerbord blinkte eine Tonne. Dahinter, vermutlich, ein Fischerboot – die Positionslichter waren kaum zu erkennen. An Backbord leuchtete ein anderes Schiff auf. Das musste ein Kreuzfahrtschiff sein, unterwegs nach Esbjerg. Unzählige kleine Fenster. Hunderte, dunkelgelb glühend. Eine kleine, über das Meer reisende Stadt. Mit Bars und Schwimmbädern an Bord. Mit mehreren Restaurants zur Auswahl. Ich stellte mir vor, wie die Leute dort herumliefen, von einem Foyer zum nächsten, als würden sie durch Straßen spazieren. Wie sie miteinander redeten. Sich fein gemacht hatten für das Captain’s Dinner. Wie sie miteinander fremdgingen oder es sich zumindest ausmalten. Wie sie betrunken wurden und einschliefen.
Mein Boot steuerte sich selbst, mühelos schob sich die See unter ihm hindurch. Ich brauchte nichts zu tun als alle zehn Minuten einmal rundum zu schauen, in einer Welt, deren Mittelpunkt noch immer mein Boot war. Wach zu bleiben war nicht schwer; in diesem übersichtlichen Kreis war jedes Licht am Horizont, jeder Schatten im Wasser eine Attraktion. Es dauerte eine Dreiviertelstunde, bis das Kreuzfahrtschiff aus meinem Blickfeld verschwunden war. Ich war der, der alles überblickte.
Vielleicht beginnt die Reise erst
Wie ein Idiot stehe ich in der Koje unter dem Vorderdeck. Das Wetter ist umgeschlagen. Das Boot schaukelt. Ich höre die Wellen gegen den Rumpf schlagen, ich höre den Hagel auf das Deck prasseln. Ich habe nicht gemerkt, dass Maria verschwunden ist. Ich kann es nicht erklären. Es muss einen Grund geben. Aber mir fällt keiner ein. Ich kann sie nicht finden. Ich habe das alles nicht kommen sehen. Plötzlich ist alles ins Gegenteil verkehrt. Die Reise ist nicht vorbei. Noch nicht. Vielleicht beginnt sie erst jetzt.
Vielleicht muss ich erst meinen Überlebensanzug wieder anziehen, bevor ich Maria suchen gehe. Aber es ist so warm. Zu warm, um hier zu bleiben, in der leeren Koje. Ich stolpere durch das Boot und klettere nach draußen, in die Plicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Hagel hat aufgehört. Jetzt nieselt es. Das Boot ist von Nebel umhangen. Als ob ich in ein Dampfbad hineingefahren wäre. Ich habe Angst, in diesem Nebel keine Luft mehr zu bekommen. Ich kann nichts mehr sehen. Ich muss mich zusammenreißen. Ich darf nicht in Panik geraten.
»Ich habe nicht gemerkt, dass Maria verschwunden ist. Ich kann es nicht erklären. Es muss einen Grund geben. Aber mir fällt keiner ein. Ich kann sie nicht finden.«
Das ist das Allerdümmste, was man auf dem Meer machen kann: in Panik geraten. In Panik kann man nicht mehr denken.
Sie kann nicht einfach verschwunden sein. Unter der Decke konnte ich noch ihre Wärme spüren. Sie kann nicht weit sein. Ich konnte nichts sehen, in der Koje. Ich konnte den Schalter nicht finden. Habe ich auch gründlich genug gesucht?
Alles nur ein Scherz
Vielleicht hat sie sich versteckt. Das wird es sein. Sie hält mich zum Narren. Spielt ein Spiel mit mir. Das macht sie öfter. Man will sie zur Schule bringen, und sie flitzt schnell mit dem Fahrrad um die Ecke. Dann hält sie an und wartet, bis man sie gefunden hat. Ich mochte diese Spielchen noch nie. Sie jagen mir immer einen Schrecken ein. Wenn ich sie gleich finde, darf ich nicht böse werden. Da muss ich aufpassen. Es war nur ein Scherz von ihr. Ich weiß, dass sie in Wirklichkeit nicht weg ist, aber allein schon der Gedanke jagt mir Angst ein.
Ich schaue in die Kajüte und rufe. »Wo bist du?«, rufe ich, aber nicht zu laut. Wenn man laut zu rufen anfängt, ist man in Panik. Und das bin ich nicht.
Sie spielt nur ein Spiel. Verdammt, warum spielt sie gerade jetzt ein Spiel, wo das Wetter umgeschlagen ist?
Ich steige wieder hinab in die Kajüte. Laufe vor. Diesmal finde ich auch den Lichtschalter. Ich knipse das Licht an.
In der Koje liegt bloß eine leere Matratze. Die Decken liegen auf dem Boden. Sie ist nicht da. Ihr Eisbär ist auch nicht da. Das Boot schaukelt. Ich muss mich festhalten. Luft holen. Mein Körper ist aus Gummi. Mein Kopf ist aus Eis. Alles, was ich sage oder denke, ist wertlos. Ich habe meine Tochter mit auf See genommen, und dort habe ich sie verloren. Sie ist weg. Sie kann unmöglich weg sein. Ich bin die ganze Nacht über wach geblieben. Ich habe alle Tonnen gesehen, alle anderen Schiffe, ich war aufmerksamer denn je. Meine Gedanken waren glasklar fokussiert.
Völlig übermüdet
Zwei Nächte ohne Schlaf sind gut machbar. Das habe ich schon öfter durchgehalten. Ich war noch nie so konzentriert, wenn ich unterwegs war. Noch nie so konzentriert wie jetzt. Das liegt an Maria. Wer ein Kind bei sich hat, ist wachsam wie ein Adler.
Solange niemand weiß, dass Maria verschwunden ist, ist sie auch nicht verschwunden.
So einfach ist das. Sie kann überall sein. Vielleicht bilde ich mir bloß ein, dass sie weg ist.
Vielleicht hat mich die Müdigkeit eingeholt. Die Müdigkeit. Bestimmt. Ich kenne das doch. Nächtelang kommst du ohne Schlaf aus und denkst, du wirst mit allem fertig. Du denkst, du brauchst gar nicht mehr zu schlafen. Ohne Schlaf bekommt der Körper einen merkwürdigen Adrenalinstoß, du bist wie auf Drogen: Alles steht dir völlig klar vor Augen, ist total übersichtlich. Aber in Wirklichkeit siehst du überhaupt nicht klar. Es kommt dir nur so vor. Ohne dass du es ahnst, bist du blind geworden. Jedenfalls halb blind.
Ich reiße mich zusammen. Ich bin der Vater. Ich denke an die Luke, die wegen der frischen Luft offen stand. Ich habe sie die ganze verdammte Nacht über offen gelassen. Vielleicht ist sie da hindurchgeklettert. Ja, so wird es gewesen sein. Durch die Luke ist sie an Deck geklettert. Schlafwandelnd ist sie über Bord gefallen. Ins schwarze Wasser. Ich darf jetzt nicht daran denken. Um Himmels willen nicht an ihren blassen Körper im schwarzen Wasser denken.
Ich laufe vor, zu der Luke. Sie ist komplett zur Seite umgeklappt, es regnet hinein. Ich suche das Deck ab. Es ist dunkel. Nichts, wohinter sie sich verstecken könnte. Ich kann nicht genug sehen. Ich steige wieder in die Kajüte, hole die Stirnlampe und binde sie mir mit einem Elastikband um den Kopf. Das Lichtbündel schwirrt wild über das Deck. Ich muss ruhig bleiben. Mit der Lampe auf der Stirn poltere ich zurück in die Plicht.
Draußen leuchte ich über die Wassermassen, die das Boot umgeben, sie sind dunkel wie Öl. Es ist schwer, darin irgendetwas auszumachen, und doch sehe ich etwas. Ich kneife die Augen zusammen, um schärfer zu sehen. Kopfschmerz schießt mir aus dem Nacken hoch. Im Wasser treibt ein Fleck, ein blasser Fleck, ich richte den Scheinwerfer darauf und erkenne zwei Augen; sie reflektieren das Licht. Es sind die Augen einer Möwe, mit zusammengelegten Flügeln treibt sie auf den Wellen, schaut zum Boot und zum Skipper. »Ich suche Maria«, sage ich zu der auffliegenden Möwe, »ich suche Maria, verdammt noch mal!«
Sie treibt im Wasser
Dann sehe ich sie. Sie treibt im Wasser. Ich sehe es ganz genau. Immer wieder verschwindet sie in einem Wellental, aber ich sehe sie. Sie treibt im Wasser dahin. Das Wasser trägt sie. Natürlich, denke ich, es ist Salzwasser, und sie ist ein Kind, sie wiegt nicht viel.
Erleichterung. Ich werde sie aus dem Wasser holen, in eine Decke wickeln, Kakao für sie machen, und dann hissen wir die Segel und fahren zum Stortemelk, durch das Wattenmeer bis nach Harlingen. Ich ziehe das Schlauchboot näher heran. Mit dem Schlauchboot werde ich sie aus dem Wasser holen. Das ist nicht ganz leicht. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Eine Schnalle der Rettungsweste hat sich hinter dem Stag verhakt. Ich mache mich frei, dann ziehe ich so kräftig an der Leine, dass das Schlauchboot mit voller Wucht gegen den Rumpf knallt. Ich schwinge mich über die Reling und springe.
Das Boot ist instabil, ich komme falsch auf, mein eines Bein hängt ins Wasser. Aber das macht mir jetzt auch nicht mehr viel aus. Besonders kalt ist das Wasser nicht. Es geht schon, das Schwimmen wird nicht so schlimm sein. Maria ist ganz nahe. Als Erstes muss ich Maria holen. Ich ziehe das Bein aus dem Wasser und löse die mit Klemmen an der Innenseite des Gummiboots befestigten Paddel. Lege sie in die Dollen und rudere zu Maria hinüber.
Maria treibt fünfzig Meter entfernt im Wasser, vielleicht hundert; Abstände richtig zu schätzen ist auf dem Meer schwierig. Ich rudere rückwärts auf sie zu, so habe ich am meisten Kraft. Ab und zu schaue ich mich um. Ob ich sie noch sehen kann zwischen den Wellen. Das Rudern kostet mich mehr Anstrengung, als ich gedacht hätte. Das Boot ist schlecht aufgepumpt, oder die Luft ist halb heraus, es flappt unter meinem Gewicht fast zusammen. Das Rudern geht immer schwerer, dann schlägt eine Welle ins Boot. Ganz allein rudere ich jetzt auf dem Meer. Bei großen Wellen knickt das Gummiboot in der Mitte ein, und dann strömt Wasser hinein. Die Paddel befördern grüne Schlieren ans Tageslicht.
Das Boot ist in eine Seegraswiese hineingeraten. Die Paddel verheddern sich, ich ziehe das Seegras hoch, die teuflischen grünen Stränge nehmen kein Ende. Ich darf die Paddel nicht so tief eintauchen, sonst komme ich gar nicht mehr voran. Ich rudere. Ich rudere mit schmerzenden Händen. Zu der verblichenen Fischerboje, von der ich denke, dass es meine Tochter ist. Ich weiß noch nicht, dass es eine verblichene Fischerboje ist.
Das weiß ich erst, nachdem ich angekommen bin und die Paddel aus dem Seegras befreit habe. Da wird mir bewusst: Hier ist keine Maria. Hier ist nur eine verwitterte orange Plastikkugel, an deren Leine sich ein totes Büschel Seegras verfangen hat. Die Leine ist mit Entenmuscheln übersät.
Keine Maria. Maria ist hier nicht. Es ist ein Scherz. Ein Test. Jemand erlaubt sich einen schrecklichen Scherz mit mir. Ich will, dass es aufhört.
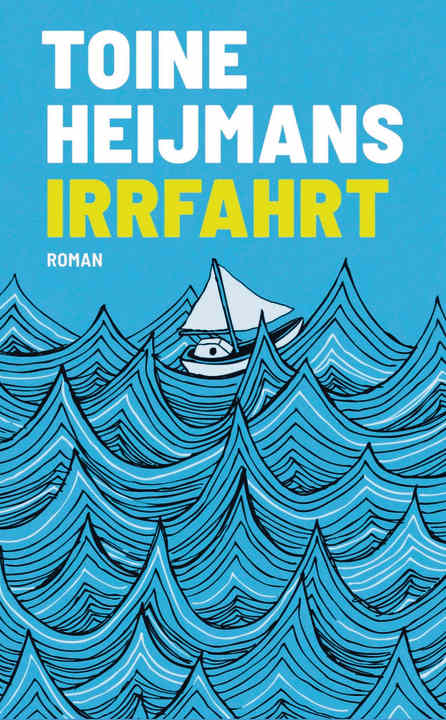
Toine Heijmans’ Roman “Irrfahrt” ist 2011 erschienen, wurde ausgezeichnet, verfilmt, und in acht Sprachen übersetzt. In diesem Jahr auch ins Deutsche. Mairisch Verlag, 16 Euro.

