Ausblick: Warum das Wetter in der Saison 2023 verrücktspielt



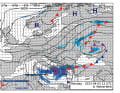
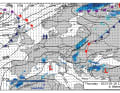
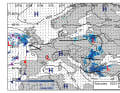
Alles begann schon vor vielen Wochen: Wir schreiben den 2. April 2023. Nach einer langen und nassen Periode taucht auf den Wetterkarten ein Hoch mit dem Namen „Nadine“ auf. Es wandert von den Azoren her in Richtung europäisches Festland. Dabei bildet sich schon einen Tag später eine sogenannte Hochdruckbrücke zwischen dem Azorenhoch und einem neu entstandenen Skandinavienhoch. Dieses Gebilde blockiert die atlantische Tiefdruckautobahn. Folge: Die Phalanx der sonst in unseren Breiten üblichen einander abwechselnden Wettersysteme wird schlagartig unterbunden. Das ist zwar nicht alltäglich. Über die Maßen ungewöhnlich ist das Geschehen in der Atmosphäre zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht. Das jedoch soll sich ändern.
Im April ahnt noch niemand, dass sich diese neu gebildete Hochdrucklage mehr oder weniger stark ausgeprägt über viele Wochen hinweg halten soll, bis weit in den Juni hinein. Viele Teile Europas geraten im April oder Mai in den Einfluss tieferen Luftdrucks samt damit einhergehender Niederschläge. Doch zugleich ist seither auf den europäischen Wetterkarten ein oft kräftiges Hoch dauerpräsent.
Luftmassen kommen ungebremst
Dessen Lage variiert, was wiederum Auswirkungen auf die Wetterparameter hat. Mit seiner Lage über den Britischen Inseln werden Luftmassen aus dem hohen Norden in den Nordsee- und Ostseebereich verschoben. Da Winde auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn um ein Hoch drehen, kommen diese Luftmassen somit ungebremst aus den Regionen um Nordnorwegen und Spitzbergen. Heißt, über die Nordsee strömend kühlt sich die Luft vor allem nachts so stark ab, dass sich See- oder Hochnebel ausbildet, den erst die Sonne am folgenden Nachmittag allmählich aufzulösen vermag.
So ergeben sich auf den Nordfriesischen Inseln dann auch nur Temperaturen von maximal zwölf Grad Celsius. Für die Ostseeseite dienen dagegen Dänemark und Schleswig-Holstein als Wärmepuffer. Auch wenn die Wassertemperaturen zunächst ähnlich sind, wird die von Norwegen kommende Luft über dem schon warmen Land so stark aufgeheizt, dass sich auf der Ostsee viel seltener Nebel bildet.
Die Sonne kommt hier daher schon erheblich früher zum Vorschein, und die Lufttemperaturen klettern teils bereits deutlich über 20 Grad – während die Segler auf Sylt zur gleichen Zeit in dicken Jacken im Cockpit sitzen.
Folgenreicher Wetterwechsel
Das Hoch bleibt wie gesagt nicht an Ort und Stelle, es wandert auch mal hinüber nach Skandinavien. Dabei geraten in den vergangenen Wochen die an den Norden Deutschlands grenzenden Meere plötzlich auf die Südseite des Druckgebildes. Die Folge: Der Wind dreht rück auf östliche Richtungen. Damit ist die Wärmebarriere für die Ostsee außer Kraft gesetzt, stattdessen wirkt sie sich nun auf Elbe und Nordsee aus. Der auflandige Wind kühlt die Küstenregionen zwischen Rügen und Flensburg, wohingegen Segler im Nordseeumfeld die vom Land erwärmten Luftmassen abbekommen und auf Vormwindkurs bei bis zu 28 Grad an Bord unversehens ins Schwitzen geraten.
Dieses Wechselspiel des Windes und der Luftmassen spiegelt das Pendeln des Hochs wider. Nach dem Skandinavienhoch schiebt sich oft direkt wieder das Azorenhoch bis über die Britischen Inseln und bildet dort ein neues System aus, das sich im weiteren Verlauf erneut über Nordeuropa platziert. Die Auswirkungen sind von Woche zu Woche immer weitreichender und bis in den mitteleuropäischen Raum spürbar. Denn die Hochs dehnen sich mit der jahreszeitbedingten zunehmenden Erwärmung der Nordhalbkugel weiter aus. Regen und Tiefs, die sich zeitweise noch mal zeigen, werden seltener. In vielen Regionen fehlt bis Mitte Juni über Wochen hinweg Niederschlag.
Die Crux: Im Gegensatz zur Wetterlage sind die Windbedingungen alles andere als von Dauer, sprich beständig. Mit dem Wandern des Hochs verändert sich nicht nur die Windrichtung. Die Druckgegensätze nehmen auch mal zu und mal wieder ab. So weht in der westlichen Ostsee einen Tag nur unter der Küste leichter Seewind mit 3 Beaufort, weiter draußen herrscht gar Flaute vor. Und am nächsten Tag ist plötzlich ein Hafentag fällig, da 5 bis 6, in Böen 7 bis 8 Beaufort aus Ost blasen.
Das alles wohlgemerkt bei angenehmen Temperaturen und strahlend blauem Himmel! Der abrupte Wetter- beziehungsweise Windwechsel kündigt sich nicht sichtbar an. Nur, wer die Wetterkarten zur Hand nimmt, weiß, dass die Lageänderung des Hochs auch eine Änderung des Windes zur Folge hat. Selbst wenn der Einfluss des Hochs auf die Atmosphäre bleibt.
Der Effekt des Seewindes
Oft sind es dann zusätzlich Tiefs, die sich vom Mittelmeer her bis nach Polen aufmachen und die Druckgegensätze des Ostwindes zusätzlich anfeuern. Legt sich darüber dann noch auf den ohnehin schon starken Wind der Effekt des Seewindes, sind es vor allem immer wieder die kräftigen Böen, die ordentlich ins Segel drücken, ohne dass die sonst dafür üblichen Kumuluswolken zu sehen sind. Unsichtbare Warmluftblasen steigen über dem Land auf. Die entstandenen „Luftlöcher“ werden schlagartig von See her aufgefüllt, sodass es kurzzeitig immer etwas böiger ist.
Stichwort Mittelmeer: Es zeigt sich auch, wo die Tiefdruckgebiete derzeit zu finden sind. Denn weg sind sie nicht, nur woandershin verschoben. Solche Systeme zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie meist einen kalten Körper haben, also kühlere Luftmassen aus großen Höhen mit herantragen. Das riesige und andauernde Hoch über dem nördlichen Teil Europas hat folglich tieferen Luftdruck ins Mittelmeer abgelenkt. Und genau dort haben wir aufgrund der höheren Sonneneinstrahlung höhere Temperaturen am Boden oder auch im Wasser.
Bildet sich hier nun ein Tief aus und bringt kalte Luft aus der Höhe mit, so tauschen sich beide Luftmassen aus. Die kalte Luft ist schwerer und will nach unten. Die warme Luft am Boden, die noch mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, wird nach oben verdrängt. Und das schlagartig an Ort und Stelle. So bilden sich dort dann auch die mächtigen Kumulonimbuswolken mit Starkregen und Gewittern.
Kaum Druckgegensätze zu finden
Da wir über das gesamte Mittelmeer in den zurückliegenden Wochen schon fast von einem Tiefdrucksumpf sprechen können, sind hier kaum Druckgegensätze zu finden. Aus diesem Grund fehlen auch Höhenwinde, die die Gewitterzellen wegtragen. Sie bleiben stationär und entfalten an einem Punkt ihr ganzes Potenzial. Das Mehr an Wasserdampf in der Luft wird schlagartig abgegeben. Das erklärt die Überflutungen in Italien, auf Mallorca oder in Barcelona, um nur einige vom Schlechtwetter betroffene Regionen zu nennen.
Da hierfür auch die Sonne ein maßgeblicher Antreiber ist, um die Luftmassen in den unteren Schichten anzuheizen, kann man die Uhr danach stellen, wann sich erneut Unwetter ausbilden. Jeden Tag sieht das Gewitterradar am Vormittag kaum etwas Auffälliges, am Nachmittag ist es plötzlich angefüllt mit Blitzen. Tag für Tag hat sich diese Lage wiederholt. Dabei meist über dem Land, seltener über dem Wasser. Nur wenige Zellen verdrifteten auch mal aufs Meer hinaus.
Etwas Dynamik zeigt sich zuletzt immerhin über Marokko: Nahe dem Atlasgebirge können sich zeitweise kräftigere Tiefs bilden, die nicht nur das Wetter zwischen den Balearen und Zadar noch etwas extremer ausfallen lassen als ohnehin schon durch die tagesgangbedingten lokalen Zellen. Sondern diese Tiefs finden ihren Weg auch bis nach Polen. Weiter geht es dann aber nicht, da hier ja immer noch die Hochs den Weg versperren. Ebendiese Tiefs sind es aber, die den Ostwind in der Ostsee bis auf 5 oder 6 Beaufort ansteigen lassen.
Der Kreis schließt sich, oder ...
Somit könnte man meinen, dass der Wetterkreis sich hier schließt. Doch sollten wir noch einen Blick auf den Atlantik werfen. Vom Azorenhoch geht unsere Hochdrucklage meist ja aus. Aufgrund der Routings vieler Segler, die aus der Karibik zurück nach Europa fuhren und noch immer fahren, zeigt sich auch hier ein phasenweise gravierend anderes Bild: Das Hoch ist oft und auch sehr lange stark ausgeweitet. Für einige Tage sieht man auf dem gesamten Nordatlantik nur ein einziges riesiges Hochdruckgebiet. Kein Tief weit und breit. Die gibt es zwar, sie sind dann meist auch recht intensiv, und insbesondere die Azoren und Kanaren hat es heftiger erwischt. Doch ihre Anzahl ist deutlich reduzierter als in den Vorjahren.
Daher fehlt auch der Wind, um zum einen die Segler auf ihrem Weg nach Hause anzutreiben, zum anderen, um die Meere umzuwälzen und frischeres Tiefenwasser heraufzuholen. Gerade entlang der Passate zeigen sich mittlerweile wesentlich höhere Wassertemperaturen, als sie in der jetzigen Jahreszeit üblich sind.
Neben der afrikanischen sieht man das auch vor der britischen Küste massiv. Das verwundert nicht, denn hier lag ja häufig und lange ein Hoch. Die Sonne konnte völlig ungestört das Wasser erwärmen. Vor der afrikanischen Küste und auch auf dem offenen Atlantik geht man aber zusätzlich dazu von anderen Effekten aus: Entweder sind die Passate durch das stark ausgedehnte Hoch ebenfalls schwach. Oder eben die Tiefs über Marokko haben das Passatwindfeld vor der Küste so gestört, dass sich Winde aufhoben und in der Folge ebenfalls keine Wasserdurchmischung im Atlantik stattfinden konnte.
Ein zusätzlicher Erwärmungseffekt kann fehlender Saharastaub sein. Sind die Tiefs nicht so stark und ihre Zugbahn verändert, wird auch der Passat abgeschwächt. Das wirbelt weniger Staub auf, der dann auf den Atlantik hinausgetragen wird. Dieser Staub dient als natürlicher Schattenspender. Er lässt nicht so viel Sonnenlicht durch und sorgt auf diese Weise dafür, dass der Atlantik nicht überhitzt. Und auch die Berufsschifffahrt und die seit einigen Jahren geringeren Mengen an Schwefel im Treibstoff könnten eine weitere Ursache sein. Fehlen Schwefelteilchen in der Atmosphäre, was in ökologischer Hinsicht zu begrüßen ist, stehen auch diese Moleküle nicht mehr als Schattenspender zur Verfügung. Mehr Sonnenlicht schafft es durch die Luftschichten bis aufs Wasser, um es zu erwärmen.
Schlussendlich kann auch das sich ankündigende El-Niño-Phänomen Effekte auf die Wetter- und damit Temperatursituation des Atlantiks ausüben. Allerdings ist nicht ganz klar, wie groß diese sind. Auch andere Effekte sind erst einmal nur Hypothesen, um zu erklären, wo dieser historisch große Anstieg der Meerestemperaturen, allen voran eben auch im Atlantik, zustande kommt.
Wie wird das Wetter während der Saison sein?
Doch wie geht es nun in der Saison weiter, wenn sich die Wettermuster doch so anders zeigen, als wir es aus der Vergangenheit kennen? Fangen wir mit einer etwas einfacheren Prognose an: Wir starten allmählich in die Hurrikanzeit. Hurrikans wird es geben, und die ersten Verdachtszonen wurden bereits von der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) auf Höhe der Kapverden gekennzeichnet. Vor wenigen Wochen wurden von der NOAA zudem Prognosen veröffentlicht, die von einem in der Anzahl moderaten Hurrikanjahr ausgehen, mit nur zwölf bis 17 solcher Wirbelstürme. Darin enthalten sind auch Tropenstürme, für die es nicht bis zur Hurrikanstärke mit mehr als 188 km/h Windgeschwindigkeit reicht.
Waschechte Hurrikans sollten in der Anzahl wohl unter zehn bleiben. Das klingt plausibel, denn in einem Jahr, in dem sich ein El Niño aufbaut, ist meist mit etwas weniger Hurrikan-Aktivität zu rechnen. Die Windzirkulation im Pazifik, dort, wo El Niño auftritt, sorgt im Atlantik meist für stärkere Passatwinde entlang der Tropen und Subtropen. Für die Bildung eines Hurrikans sind zu hohe Winde allerdings kontraproduktiv. Beim anfänglichen Verwirbeln würden sie die Scherung und das Eindrehen verhindern.
Beispiel: Ziehen Sie in der vollen Badewanne oder Spüle einfach mal den Stöpsel, warten Sie, bis sich der obligatorische Wirbel bildet, und pusten Sie dann kräftig hinein. Der Wirbel sollte sich auflösen.
Man geht also von einer normal hohen Zahl tropischer Wirbelstürme aus. Sollten sich welche bilden, kommen allerdings die höheren Wassertemperaturen ins Spiel. Höhere Temperaturen bedeuten auch mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre und somit mehr Energie, die zur Verfügung steht. Die Wirbelstürme dürften also deutlich an Intensität gewinnen.
Was das für die Nord- und Ostsee bedeutet
Was hat das nun mit den Wettersystemen über der Nord- und Ostsee und der Prognose für die restliche Saison zu tun? Tatsächlich eine ganze Menge. Sollten sich Hurrikans bilden, so folgen sie meist den Höhenwinden und biegen bei der Karibik oder den USA nach Norden ab, sobald das Azorenhoch schwach genug wird, um dies zuzulassen. Sind die Stürme nun stärker, könnte das Auswirkungen haben, sobald sie in die außertropische Tiefdruckzone der mittleren Breiten eintauchen.
Nicht selten findet man auf einer Wetterkarte Namen wie zum Beispiel Ex-„Sandy“ oder Ex-„Mitch“. Das sind Tropenstürme, die als normales Tief auf Europa treffen. Die sind es oftmals auch, die eine zuvor länger andauernde Hochdrucklage beenden, um eine wechselhaftere Phase mit mehr Tiefs einzuläuten.
In diesem Jahr steht nun aber zu befürchten, dass die Tropenstürme ihre Stärke länger beibehalten und mit erheblich höheren Windgeschwindigkeiten auf Europa treffen. Ihre Lebensenergie ziehen sie dabei aus den höheren Wassertemperaturen. Das erklärt, warum sich abgeschwächte Hurrikans im sehr warmen Golf von Mexiko oftmals wieder verstärken.
Energiegeladenes Wetter
Gerade bei den derzeitigen Abweichungen der Wasserwerte um die Britischen Inseln herum steigt das Risiko, dass sich Stürme dort noch mal Energie holen könnten. Somit gibt es zwei potenzielle Szenarien für die weitere Saison: Entweder wir sehen ein fortdauerndes kräftiges Hoch im Dunstkreis der Nord- und Ostsee, gestützt von dem regelmäßigen Übergreifen des Azorenhochs. Alles bleibt also beim Alten. Es geht häufig schwachwindig zu. Nur entlang der Küsten sorgt Thermik für segelbaren Wind. Dazu steigen die Luft- und Wassertemperaturen weiter an. Allerdings werden sich hier immer wieder phasenweise Tiefs dazwischen mogeln, die unter dem Hochdruckeinfluss aber an Kraft verlieren.
Lediglich kleine Störungen, ausgehend von den Tiefs, werden auch mal für den einen oder anderen stärkeren Sommerschauer gepaart mit Gewittern sorgen. Tiefs, die vom Mittelmeer her den Weg nach Norden finden, könnten dann für eine gewisse Zeit den oft östlichen Gradientwind wieder ansteigen lassen.
Oder aber ein grundlegender Wetterwechsel wird durch einen Tropensturm in Gang gesetzt. Aufgrund der Jahreszeit sind die stärksten Temperaturunterschiede zwischen unseren Breiten und der Arktis weiter nach Norden verschoben. Somit finden wir dort unseren Jetstream, der die darunterliegenden Tiefs steuert.
So braucht es gerade in der aktuellen Zeit mit den sehr hohen Temperaturen, die sich weit nach Norden ausdehnen, nun umso mehr eine Initialzündung. Beispielsweise in Form eines Wirbelsturmes auf dem Atlantik! Ob und wann der kommt und die Lage verändert, ist aber sehr unsicher.
Somit ist eher von der ersten Option auszugehen: dass das massive Hoch über weiten Teilen Europas weiter Nahrung erhält und unverändert das Wettergeschehen bestimmt. Land- und Wassermassen werden sich weiter aufheizen.
Klingt für Segler erst einmal nach einer tollen Saison wie im Jahr 2018. Doch andererseits wird dies das Regendefizit in vielen Teilen Europas verstärken. Zudem: Wassertemperaturen wie im Mittelmeer von 24 Grad und mehr in der Ostsee sind für die Ökosysteme im Norden nicht gut.
Man muss also schon fast hoffen, dass sich bald ein großer Tiefkomplex bei Island oder gar ein Hurrikan bildet, der abgeschwächt den Weg zu uns nach Europa findet und diese ungewöhnlich festgefahrene Hochdrucklage wieder zu einer mit Westwinden und Regen ändert. Auch wenn darunter die Freude an sonnigen Segeltagen ein wenig leidet.
Sebastian Wache

