Bordgetränke: Mit diesen Spirituosen wird die Bordbar zur Seemannskneipe
YACHT-Redaktion
· 03.10.2024

Splice the mainsheet! Wenn auf den alten Rahseglern der letzte Handgriff eines Manövers getan war, erscholl dieses abschließende Kommando zum Rum-Empfang. Mit Entdeckung der Segelei als Freizeitvergnügen wurde diese Tradition gern übernommen, und seither gehört es für viele zum geregelten Bordleben, nach dem Aufklaren gemeinsam anzustoßen.
Auch Rum hat immer noch seine Liebhaber, der Reigen populärer Bordgetränke ist heute jedoch um einiges vielfältiger und umfasst auch solche ohne Alkohol. Ein hochprozentiger Manöverschluck ist mittlerweile eher verpönt, das erwähnte Kommando, übersetzt bedeutet es „Besanschot an!“, daher nur noch Geschichte.
Leckere Sundowner-Rezepte:
Buchtipp: Cocktails nach Beaufort
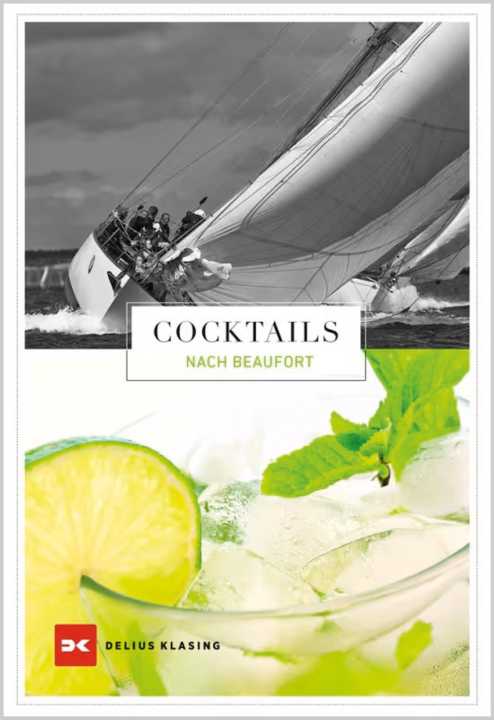
Von flau bis stürmisch: In dieser Sammlung von klassischen bis zu exotischen Sundownern und Bordgetränken ist alles dabei. Delius Klasing, 19,90 Euro
Zeitlos ist jedoch das Bedürfnis, nicht nur die gut zusammenarbeitende Crew, sondern auch eine fröhliche Bordgemeinschaft zu sein. Und das kann unter anderem im gemeinsam genossenen Drink Ausdruck finden. Ganze Bücher sind über dieses Ritual veröffentlicht worden, Charterunternehmen geben Empfehlungen auf ihren Internetseiten, Einkaufslisten inbegriffen. Sogar ganz eigene Wortschöpfungen hat das zeremonielle Bordgetränk schon hervorgebracht, vom An- und Ableger über das Ankerpils bis hin zum Five O’Clock Tea, mit dem nicht das in Großbritannien übliche Heißgetränk, sondern der nach Long Island benannte Eistee gemeint ist.
Manche Segler erinnern sich noch an die einst populäre Sherrytime, und es soll Yachten geben, auf denen der Abend so lang wird, dass mit einem Tequila Sunrise endet, was mit dem Sundowner anfing. Nicht selten wurden an Bord von Segelyachten Vorlieben entwickelt, die sich von denen an Land erheblich unterscheiden, Lieblingsgetränke, für deren Genuss außerhalb der heimischen Komfortzone manchmal beachtlicher Aufwand betrieben wird. Wir haben einige der beliebtesten zusammengestellt.
Rum: Aus der Karibik in die Welt

Rum galt einst als Ersatz für Bier und Wein und ist aus der Seefahrt heute nicht mehr wegzudenken
Die Geschichte des Rums beginnt mit den schlechten Lebensbedingungen an Bord in früheren Jahrhunderten. Um die Besatzung bei Laune zu halten, gab der Kapitän seiner Crew Rationen von Bier oder Wein. Ein Problem trat auf, als die Schiffe immer längere Strecken zurücklegten: Die Getränke überstanden die lange Fahrt – zum Beispiel über den Atlantik in die Neue Welt – nur selten. Der Wein wurde zu Essig und das Bier verdarb. Doch die Lösung dieses Problems fand man schließlich in der Karibik – der Geburtsstätte des Rums. Im 17. Jahrhundert bauten Farmer dort Zucker auf ihren Plantagen an, im fernen Europa ein wertvolles Gut. Bei der Weiterverarbeitung blieb Melasse übrig, die sich gut vergären und brennen ließ. Daraus entstand genau das, was die Kommandeure auf langen Reisen brauchten: ein Getränk, das haltbar und betäubend ist.
Künftig ersetzte Rum das Bier oder den Wein an Bord. Täglich erhielten die Seeleute eine Ration des Karibikschnapses. Zunächst war es ein Pint, also etwa ein halber Liter. Doch das konnte nicht lange gut gehen. Also wurde der Rum mit Wasser gestreckt und mit Zitrone versehen – fertig war der Grog. Zugleich waren die Früchte in dem Drink ein hilfreiches Mittel gegen Skorbut. So ist der Rum im Laufe der Jahrzehnte unverzichtbar geworden. Deshalb lagerte die Royal Navy ständig welchen ein. Gleichzeitig lag bei den Destillen stets ein Kriegsschiff vor Anker, damit der Nachschub gesichert war.
Eine Win-Win-Situation: Die Brenner waren so vor Piratenangriffen geschützt und die Navy hatte zufriedene Crews. Diese Verbundenheit hält bis heute an: Noch immer sponsert die auf Barbados ansässige Mount-Gay-Destillerie regelmäßig Segelregatten. Eine ihrer berühmten roten Caps erhält nur, wer eine Mount-Gay-Wettfahrt beendet hat. In der Royal Navy gibt es übrigens seit 1970 keine Rumzuteilungen mehr – man entschied, dass sie nicht zu den Atomsprengköpfen an Bord passten.
Rezepte mit Rum
Mojito

- 1 Stk Bio-Limette
- 2 TL Rohrzucker
- 3 Stl Minze
- 5 cl weißer Rum
- 5 Stk Eiswürfel
Limettenstücke mit dem Zucker in ein Glas geben. Die Minze waschen und trocken tupfen. Einige Blättchen zum Garnieren beiseitelegen. Der Rest wird leicht zerdrückt und hinzugegeben. Mit einem Stößel die Limettenstücke und den Zucker zerstoßen. Den weißen Rum mit Eiswürfeln hinzufügen und alles verrühren. Mit Sprudelwasser auffüllen und mit Minze garnieren.
Hurricane

- 5 cl weißer Rum
- 5 cl brauner Rum
- 5 cl Passionsfruchtsaft
- 3 cl Orangensaft
- 2 cl Limettensaft
- 1 TL Zuckersirup
- 1 TL Grenadine
- 1 Stk Orangenscheibe
- 1 Stk Cocktailkirsche
Die beiden Rumsorten, Fruchtsaft, Zuckersirup und Grenadine in einen Shaker geben und circa 20 Sekunden kräftig schütteln. Den Mix anschließend in ein Longdrinkglas füllen. Vor dem Servieren wird das Glas mit einer Orangenscheibe und der Cocktailkirsche garniert.
Linie Aquavit: Auf See gereift

Zweimal kreuzt der norwegische Linie-Aquavit den Äquator – zugunsten des Geschmacks
Oft sind es Zufälle, die in der Geschichte Neues hervorgebracht haben. Auch der Ursprung dieser hochprozentigen Spirituose geht vermutlich auf einen solchen Zufall zurück. Den Erzählungen zufolge soll im Jahr 1807 der Schoner „Trondhjems Prove“ von einer Weltreise nach Norwegen heimgekehrt sein. Das Schiff war unterwegs, um getrockneten Kabeljau nach Südamerika zu transportieren. Mit an Bord waren auch Aquavit-Fässer. Etwa seit dem 16. Jahrhundert soll es den mit nordischen Kräutern gewürzten Branntwein in Norwegen geben. Zurück im Heimathafen entdeckte man, dass einige Fässer die Reise ungeöffnet überstanden hatten.
Beim Probieren stellte man fest, dass der Aquavit nach der Überfahrt deutlich milder und sanfter schmeckte als davor. Also wiederholte man das Verfahren: Immer wieder lagerte man den Schnaps unter Deck. Schließlich wurde die sogenannte Reifereise zur Regel gemacht, da man den verbesserten Geschmack auf die ständige Bewegung, die Seeluft und die Temperaturschwankungen während der Überfahrt zurückführte. Heute heißt es vom Hersteller, dass die hölzernen Sherryfässer sich während der Seereise ausdehnen und zusammenziehen. Das ermögliche es dem Schnaps, die reichen würzigen Essenzen aufzunehmen, die sein komplexes Geschmacksprofil definieren.
Und noch heute reist Linie-Aquavit für den besonderen Geschmack in blauen Containern gelagert über die Weltmeere und kreuzt dabei mindestens zweimal den Äquator. Diese Tradition ist sogar staatlich garantiert und auf den Flaschen nachvollziehbar. Auf jedem Rücketikett sind das Reisedatum und der Name des Schiffes vermerkt, auf dem die Reifereise absolviert worden ist. Und während die traditionelle Spirituose in Deutschland eiskalt getrunken wird, genießt man sie in Norwegen bei Zimmertemperatur, denn so sollen die vielfältigen Aromen – unter anderem von Dill und Kümmel – besser zur Geltung kommen.
Gammel Dansk: Ein Schluck dänische Kultur

Auf vielen Yachten gehört der Magenbitter Gammel Dansk zur medizinischen Grundausstattung
Fast dreißig Gewürze stecken in dem dänischen Verdauungsschnaps Gammel Dansk. Die Liste reicht von Anis und Ingwer über Muskatnuss bis hin zur Vogelbeere. Sie sorgen für den bitteren und kräuterartigen Geschmack. Nicht selten ist er die Geheimwaffe der Bordbar, wenn der Crew die Kost des Smutjes schwer auf dem Magen liegt. Doch auch als Aperitif ist er vor allem bei Dänen ein beliebter Likör. Er gilt als Symbol für dänische Tradition und Kultur und wird entweder pur oder mit Eis und Zitrone getrunken. Zusätzlich wirbt das Flaschenetikett damit, dass er schon morgens seine anregende Wirkung entfaltet. Wie sinnvoll das vor dem Segeln ist, muss jeder selbst entscheiden.
Portwein: Stark und Süß

Der vergleichsweise hohe Alkoholgehalt des Portweins hat gleich mehrere Vorteile
Portwein ist eine besondere Form des Weins aus dem portugiesischen Douro-Tal. Doch maßgeblich zur Entdeckung des Süßweins beigetragen haben die britischen Seefahrer, denn sie verschifften zu Beginn des 18. Jahrhunderts große Mengen Wein aus Portugal gen Norden. Dabei bemerkten sie, dass die Weine den Transport per Segelschiff besser überstanden und danach besser schmeckten, wenn man während der Gärung zusätzlich Alkohol zugab. Heraus kam ein süßer, fruchtiger Wein mit intensivem Aroma. Die konservierende Wirkung ist der Grund dafür, dass Portweine oft ein hohes Alter haben können.
Gin: Das Tonicwasser spielt die Musik

Gin erfreut sich stetig wachsender Popularität und gehört mit Tonic gemixt zu den Longdrink-Klassikern. Einst war der Wacholderschnaps vor allem bei Seeleuten beliebt, die in fernöstlichen Gefilden unterwegs waren
Die Verbreitung des Gins nahm ihren Anfang in den Niederlanden. Populär gemacht haben ihn ab dem 17. Jahrhundert jedoch die Engländer. Besonders beliebt war die Spirituose zunächst in den unteren Schichten. Aus Getreide gebrannt und nicht besteuert, war sie verhältnismäßig günstig, und schon nach wenigen Schlucken begann sich ihre Wirkung zu entfalten. Seinen charakteristischen Geschmack erhält der Schnaps durch Aromen wie Koriander oder Wacholderbeeren. Speziell den Beeren wurde eine heilende Wirkung gegen Sodbrennen nachgesagt. Das war vor allem für britische Seeleute nützlich, die in den fernöstlichen Kolonien oft scharfes Essen zu sich nahmen. Gemischt mit Tonic hatte das Getränk einen weiteren Vorteil: Das Chinin im Tonic diente als Malaria-Prophylaxe und war in diesen Gebieten sehr willkommen.
Leider war reines Tonic sehr bitter und kaum trinkbar. Daher wurde eine Lösung gefunden: Neben Gin kam auch eine Zitrone ins Getränk. Sie half gegen Skorbut – und so entstand der perfekte Tropendrink für britische Ostindienfahrer. Heute gehört der Gin Tonic zu den Cocktail-Klassikern, weshalb Gin in keiner guten Bordbar fehlen darf. Und auch wenn Tonic, die Zitrone oder das Eis an Land geblieben sein sollten – kein Problem. Seit einigen Jahren setzt sich ein neuer Trend durch. So wird Gin auch schon mal ohne Tonic getrunken. Schließlich werden moderne Wacholderbrände weniger scharf gebrannt als die klassischen Dry Gins aus London. Auch alkoholfreie Alternativen erfreuen sich zunehmender Popularität. Sie werden größtenteils wie herkömmlicher Gin hergestellt, allerdings ohne den Schritt der Destillation.
Rezepte mit Gin
Gin Tonic

- 1 Stk Zitronenscheibe
- 4 cl Gin
- 3-4 Stk Eiswürfel
- 12 cl Tonic Water
Mithilfe der Zitronenscheibe wird der Rand eines Glases befeuchtet. Anschließend werden die Kräuter fein gehackt und auf einen Teller gegeben. Dieser sollte rund 10 cm größer sein als das Glas. Den angefeuchteten Glasrand in den gehackten Kräutern drehen, sodass diese haften bleiben. Bis zur weiteren Verwendung wird das Glas kühl gestellt. Danach den Gin mit den Eiswürfeln einfüllen und langsam das Tonic Water angießen.
Seven Seas

- 4-5 Stk Eiswürfel
- 2 cl Gin
- 4 cl Pisang Ambon
- 1 Spr Crème de Banane
- 20 cl Tonic Water
- 1 Stk Cocktailkirsche
Eiswürfel in ein Longdrinkglas geben. Den Gin und die beiden Liköre dazugeben. Bei Pisang Ambon handelt es sich um grünen Bananenlikör, der ursprünglich aus Indonesien stammt. Crème de Banane ist auch ein cremiger Fruchtlikör. Anschließend das Tonic Water angießen. Alles mit einem Stirrer (oder einem langen Löffel) verrühren. Mit Cocktailkirsche und Strohhalm servieren.
Champagner: Mehr als nur Champagnersegeln
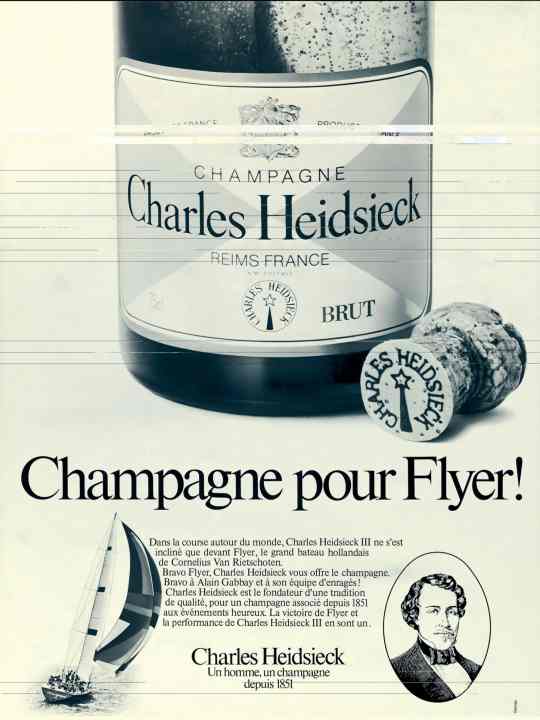
Es sind nicht nur lautmalerische Wortschöpfungen, die den edlen Schaumwein mit dem Segeln verbinden
Segeln und Champagner haben viele Gemeinsamkeiten. So ruft der Begriff des „Champagnersegelns“ bei Seglern Bilder von blauem Wasser, einer frischen Brise und dem Sprudeln entlang der Wasserlinie während der rauschenden Fahrt hervor. Bei vielen erzeugt das tatsächlich ein berauschendes Gefühl – ähnlich wie der Genuss von Champagner. Doch ob dieser Begriff tatsächlich so herzuleiten ist, bleibt unklar. In keinem Duden, Lexikon oder Wörterbuch findet man ihn. Dennoch passt er perfekt und wird oft von denen verwendet, die die Schönheit des Segelns schätzen.
Auch die berühmte Champagnermarke Charles Heidsieck, eine der weltweit ältesten für Schaumweine, pflegt eine besonders enge Beziehung zum Segelsport. Viele berühmte Segelyachten trugen diesen Namen, wie zum Beispiel die „Charles Heidsieck IV“ aus dem Jahr 1984. Der Trimaran war damals der größte der Welt – genauso lang wie breit und ein Pionier in dem Versuch, mit Foils übers Wasser zu fliegen. Allerdings scheiterten die Versuche: Die Yacht war zu schwer zum Fliegen und die Kosten des Projekts sprengten das Budget. Mittlerweile segeln seit einigen Jahren alternative Frachtsegler für Heidsieck über die Weltmeere, zum Beispiel der 24 Meter lange Aluminiumschoner „Grain de Sail“. Sechsmal im Jahr überquert das Schiff den Atlantik und liefert edlen Champagner für den US-amerikanischen Markt.
Schiffsmumme: Aus Braunschweig in die Welt

Einst war es ein Exportschlager der frühen Neuzeit, heute ist die „Schiffsmumme“ bei Touristen beliebt
In den meisten Bordbars wird dieses obergärige Braunschweiger Bier wohl kaum zu finden sein. Doch dank seiner langen Seefahrtstradition ist es ein skurriles Souvenir im Schrank und stets eine Anekdote wert. So war die erstmals im 15. Jahrhundert gebraute Braunschweiger Mumme angesichts ihres hohen Alkohol- und Zuckergehalts besonders lange haltbar und eignete sich daher vor allem für weite Reisen. Um die Haltbarkeit noch weiter zu erhöhen, wurde der Alkoholgehalt sogar verdoppelt, wodurch die „Doppelte Schiffsmumme“ entstand. Selbst in tropischen Regionen blieb das Bier genießbar und half, das Risiko von Skorbut zu verringern.
Das noch heute verwendete Markenzeichen – ein ovales Siegel mit einem weißen Dreimaster auf blauem Grund – stammt aus jener Zeit. Das Bier war wegen seiner konservierenden Eigenschaften viele Jahrzehnte lang erfolgreich und wurde ein vorindustrieller Exportschlager der Stadt. Über Celle, die Aller und später Häfen wie Hamburg, Lübeck und Bremen wurde es in alle Welt verschifft. Mit der Verbesserung der Konservierungstechniken nahm die Beliebtheit des Braunschweiger Starkbiers jedoch immer mehr ab. Heute ist es vielmehr ein alkoholfreies Malzextrakt, das Speisen und Getränken eine würzige Note verleiht. Zu kaufen gibt es die Mumme noch in Tourist-Informationen der Stadt Braunschweig oder bei der Brauerei Nettelbeck.
Whisky: Lang währt gut
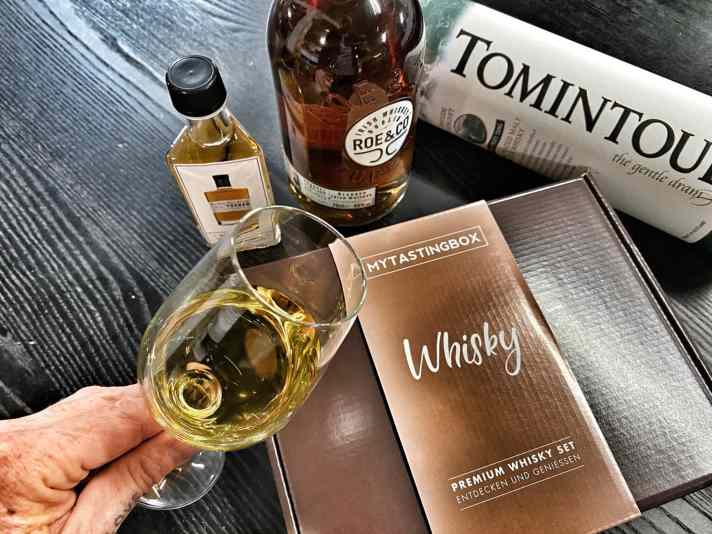
Die Reife entscheidet über die Qualität eines Whiskys – aber auch der Ort der Lagerung
Whisky wird aus Getreide hergestellt, das zuvor mit Wasser und Hefe vergoren wurde. In großen Kesseln wird die Maische zu einem Brand destilliert, der anschließend in Holzfässern lagert. Vor allem dieser Schritt, die Lagerung, ist für den Geschmack von großer Bedeutung. Zwischen 3 und 25 Jahren braucht die Spirituose, um vollends zu reifen. Kein Wunder also, dass in dieser Zeit vor allem die Holzart oder die frühere Nutzung der Fässer eine Rolle spielt. So ist es entscheidend, ob sie zuvor mit Sherry, Rum, Cognac oder Portwein gefüllt waren oder aus amerikanischer Weißeiche oder europäischer Eiche gefertigt wurden.
Mindestens genauso wichtig ist jedoch die geografische Lage des Lagerhauses. Denn die umgebende Luft bereichert das Destillat während der Lagerung. Viele der weltweit besten Whiskys kommen aus Schottland oder Irland. Dort werden sie meist auf kleinen Inseln oder nahe der Küste gebrannt. Vielleicht ist das der Grund, warum in jedem Glas Whisky auch ein Hauch von Seefahrt, Meer und Weite steckt – und ein guter Schluck an Bord am Ende eines kalten Segeltages für besondere Wärme sorgen kann.
Rezept mit Whisky
Sazerac

- 1 Stk Würfelzucker
- 3 Spr Peychaud’s Bitters
- 3-4 Stk Eiswürfel
- 6 cl Rye Whiskey
- 1 Spr Absinth
- 1 Stk Bio-Zitronenschale
Zwei Gläser vorkühlen. Würfelzucker in ein Glas geben. Bitters dazuträufeln. Den Zuckerwürfel leicht zerdrücken. Eiswürfel und Whiskey dazugeben und etwa 45 Sekunden rühren. Die Innenseite des zweiten Glases mit Absinth benetzen. Shaker-Inhalt in das Glas abseihen und garnieren.

