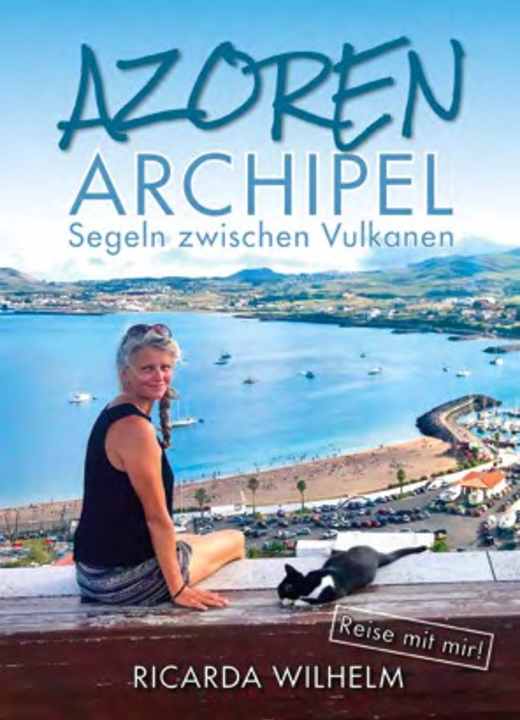Ein Text von Ricarda Wilhelm
Endlich, nach 26 Tagen und Nächten scheinbar endlosem Meer ist es geschafft: Voraus taucht die Silhouette von Hiva Oa auf. Unsere bisher längste Ozeanpassage liegt hinter uns. Das letzte Land, das wir gesehen hatten, waren die Las-Perlas-Inseln vor der Küste Westpanamas. Nun sitze ich im Bugkorb und genieße diesen bewegenden Moment. Und frage mich, was uns erwartet. Wie viel von der ursprünglichen polynesischen Kultur ist noch übrig? Welche Entdeckungen werden wir auf den Marquesas-Inseln machen, was für Menschen begegnen?
In der Gendarmerie von Atuona klarieren wir ein. Herzlich werden wir willkommen geheißen. Als Europäer dürften wir drei, unser Boot allerdings nur zwei Jahre lang bleiben. „Genießen Sie die Marquesas. Sie sind wunderschön. Wenn irgendetwas ist, helfe ich Ihnen gern“, gibt uns der freundliche Polizist mit auf den Weg. Der zweite Gang führt in den Supermarkt. In den Regalen finden sich neben lokalen Produkten auch verschiedene Waren aus Frankreich und Neuseeland. Alles ist verhältnismäßig teuer. Darauf waren wir vorbereitet, die Inseln liegen schließlich so abgelegen wie wenige andere Orte auf der Welt. Die Obst- und Gemüseauslagen sind allerdings dürftig. In den nächsten Tagen lernen wir, wie man auf den Inseln für den Obstvorrat an Bord sorgt.
Schlendern in Atuona
Atuona lädt zum Schlendern ein. Wir entdecken eine Gauguin-Ausstellung. Der Maler setzte die Frauen auf „Te Fenua Enata“, den „Inseln der Männer“, wie die Marquesas vor ihrer Entdeckung durch die Europäer hießen, in Szene. Steinskulpturen schmücken den Festplatz des Ortes. Sie zeugen von der indigenen Kultur Polynesiens. In übergroßen Köpfen auf viel zu kleinen Körpern werden Augen und Mund besonders betont. Bei den Figuren handelt es sich um Tikis. Wir werden ihnen in den folgenden Wochen überall auf den Marquesas begegnen.
Ein christliches Gotteshaus steht ganz in der Nähe. Aus dem Nebengebäude schallt vielstimmiger Gesang. Neugierig schaue ich durchs offene Fenster. Männer und Frauen sitzen an Tischen, einige spielen Gitarre und Ukulele. Die ungewohnten Laute des Marquesanischen klingen weich und harmonisch. Manche der Frauen tragen eine Frangipaniblüte über dem Ohr – wie auf Gauguins Bildern.
Im Ankerfeld liegen mehrere Yachten, deren Crews schon länger hier sind. Wir werden mit Früchten versorgt. „Ihr müsst die Einheimischen fragen. Sie verschenken und verkaufen Obst. Ihr könnt es auch gegen Leinen oder Angelhaken eintauschen“, rät uns ein deutsches Seglerpaar, das schon seit drei Monaten auf den Marquesas ist. „Polynesien ist nicht nur wunderschön, hier können wir auch ohne Risiko die Hurrikansaison verbringen“, erzählen die beiden.
Um Hiva Oa zu erkunden, kann man sich einen Mietwagen nehmen und einige Ausgrabungsstätten besuchen. Oder das Eiland segelnd umrunden. Unser Plan: Erst über Tahuata im Uhrzeigersinn in den Inselnorden und dann vom östlichsten Kap mit einem Anliegerkurs nach Fatu Hiva. Von dort soll es anschließend zu den nördlichen Inseln Ua Huka, Nuku Hiva und Ua Pou gehen. Damit liegen alle bewohnten Inseln auf unserer Route.
Ankerplatz vor Nachbarinsel Tahuata
Durch den Canal du Bordelais segeln wir mit schräg achterlichem Wind zu unserem ersten Ankerplatz, der Baie Hanamoenoa auf der nahen Nachbarinsel Tahuata. Unsere „Lady“ rauscht durchs Wasser, was die Aufmerksamkeit einer Gruppe Delphine auf sich zieht. Mit langen Sprüngen kommen sie, um in unserer Bugwelle zu surfen. Der sandige Grund in der Ankerbucht gibt sehr guten Halt. Die Kulisse ist großartig: Schwarze Felsen, an denen sich die Dünung weiß schäumend bricht, rahmen einen golden leuchtenden Strand mit Kokospalmen ein.
Das türkisfarbene Wasser lädt zum Schnorcheln ein. Fische in allen Farben knabbern an den mit Algen bewachsenen Felsen. Plötzlich schwebt ein riesiger Manta unter uns hindurch. Galant dreht er Saltos und präsentiert sich in seiner ganzen Pracht. Gebannt schauen wir zu und vergessen die Zeit.
Über den Kanal zurück nach Hiva Oa nehmen wir anschließend Kurs auf deren Nordwestküste. Die ist deutlich felsiger und trockener als die Südseite. Einzelne Büsche bedecken den steinigen Boden, der mal silbergrau, mal rötlich schimmert. Am Kap Kiukiu empfangen uns eine unangenehme Kabbelsee und Gegenwind. Erneut kommen Delphine, mindestens 20 sind es diesmal. Sie begleiten uns bis in die Baie Hanamenu. Auch hier ist das Panorama spektakulär: Beidseits von Seevögeln bevölkerte Felswände umrahmen ein enges grünes Tal. Mittendrin die Überreste eines verlassenen Dorfs. Ein einziger Obstbauer lebt noch hier. Er bewirtschaftet einen weitläufigen Garten, in dem Mangos, Zitrusfrüchte, Kokosnüsse und Papayas gedeihen. Die Pampelmusen an den Bäumen sind so groß, dass sich deren Zweige bis auf den Boden biegen.
Der Bauer begrüßt uns herzlich, bietet Mangos und Zitronen an. Auf meine Frage, was es kostet, wehrt er ab. „Ich möchte tauschen, habt ihr Rum?“, fragt er. Ich schüttle traurig den Kopf. „Alles leer, der Weg hierher war zu weit“, fällt mir eine Ausrede ein, um den freundlichen Mann nicht in Verlegenheit zu bringen. Ob wir Kartuschen hätten, setzt er nach. Als ich ihn ratlos anschaue, holt er eine Packung Munition hervor. Wir erfahren, dass die Einheimischen damit wilde Ziegen erschießen, die sich auf den Inseln ausgebreitet haben.
Die Nordküste Hiva Oas
Mit einem langen Kreuzschlag segeln wir gen Osten in die Baie Hanaiapa. Unterwegs bestaunen wir die zerklüftete Nordküste Hiva Oas. Vom Gebirgskamm, der sich von Ost nach West über die Insel zieht, fallen schmale, steinige Bergrücken zum Ufer ab. Nur die oberen Hänge sind mit einem grünen Flaum bedeckt. Offenbar regnen sich die Wolken auf der Südseite ab.
Hanaiapa ist ein lebendiges und sehr gepflegtes Dorf. An einem Samstag wird es von vielen Insulanern als Sommerfrische genutzt. Picknicktische und Bänke stehen unter schattigen Baumkronen. Frisch gewaschene Pick-ups blinken in der Sonne. Mit Kühltruhen, Surfboards und Badesachen genießen Marquesaner ihr Wochenende. Wir beobachten das Anlanden eines Auslegerbootes, das Passagiere absetzt. Frisch gestrichen, leuchtet es wie ein Zitronenfalter auf dem blauen Meer. Es gibt keinen Steg, alle müssen vor dem steilen Steinstrand ins tiefe Wasser springen. Bloß die Köpfe gucken noch heraus. Nur kleine Kinder und das Gepäck bleiben im Boot, das von den Erwachsenen nun an den Strand geschoben wird. Über Palmstämme wird der Kahn mit vereinten Kräften den steilen Hang hinaufbefördert. Das ist mühsam, doch alle haben gute Laune.
Gegen Wind und Strom zum Ostkap
Am nächsten Morgen starten wir mit weiteren Kreuzschlägen gegen Wind und Strom zum Ostkap. Verdammt, die Wetterprognose hatte Windrichtung und -stärke ganz anders vorhergesagt! Entnervt werfen wir schließlich den Motor an. Am Kap brandet der Pazifik gewaltig gegen den Fels. Beeindruckend, und das bei nur zehn Knoten Wind. Da kann man sich ausmalen, was hier bei Sturm los ist. Als wir ums Kap herum sind, können wir abfallen und wieder Segel setzen. Schon bald darauf kommt Fatu Hiva in Sicht.
Während wir den Westen der Insel passieren, geht die Sonne unter und taucht die erodierte Felsküste in warmes Licht. Der Stein schlägt senkrechte Falten wie bei einem Damenrock. Schmale Minarette stehen in der senkrechten Wand. Aus jeder Perspektive entdecke ich neue Skulpturen.
Dann biegen wir in die Jungfrauenbucht ein – und bekommen den Mund nicht mehr zu: Mutter Natur inszeniert hier mit den Resten einer Kraterwand ein gewaltiges Eingangstor aus Basalt. Hanavave liegt im Grund des großen inselbildenden Vulkankraters, umrahmt von schmalen, nackten Wänden, die bis zu 360 Meter hoch in den Himmel ragen. Weitere kleinere Vulkanberge bilden eine abwechslungsreiche Landschaft. Regenwasser rinnt an den Felswänden hinab und speist einen Fluss.
Von Mangelware und Kunstwerken auf den Marquesas
Diese geradezu paradiesischen Bedingungen nutzen die Anwohner reichlich. Das Tal quillt über von unterschiedlichsten Obstbäumen. Kaum haben wir einen Fuß ins Dorf gesetzt, werden uns Pampelmusen, Mangos und Brotfrucht angeboten. Hühner, Schweine und Ziegen gibt es ebenso in großer Zahl, sogar einige Kühe. Die Selbstversorgung scheint hier zu funktionieren. Ein kleiner Laden verkauft zudem exotischere Produkte wie Reis, Zucker, Shampoo und Schokolade. Nur Gemüse ist Mangelware. Die Versorgungsschiffe „Aranui 5“ und „Taporo IX“ kommen zwar regelmäßig aus dem 1.000 Seemeilen entfernten Papeete. Aber niemand weiß vorher genau, was und wie viel sie bringen.
In Hanavave kommen wir am Grundstück von Sissi und Simon vorbei. In ihrem Garten liegen zwischen all dem Grün grob bearbeitete Steinblöcke. Simon ist Tischler und Bildhauer, seine Frau versteht sich in der Kunst des Schnitzens. „Ich habe das von meinem Vater gelernt“, erzählt sie. Unversehens stehen wir in einer Werkstatt mit etlichen Tiki-Figuren aus Holz und Stein in den unterschiedlichsten Größen und Fertigungsphasen.
Dann zeigt uns Simon stolz seine Tischlerarbeiten. Unter anderem einen Tisch mit Schachbrettmuster, umrandet mit einem breitem Rahmen und mit geschnitzten Tikis verziert: Es ist ein wahres Kunstwerk! Simon verwendet schwarzes Ebenholz und rotbraunes Rosenholz. Zwei perfekt gearbeitete Stühle, deren Rückenlehne mit marquesischen Mustern verziert ist, stehen bereits fertig daneben.
Simon erklärt mir das Marqueserkreuz. Dieses Muster finden wir auf vielen seiner Arbeiten. „Innen siehst du die Inseln, drum herum das Meer. Der Rand stellt die Mutter Erde im Universum dar. Deshalb ist das Symbol rund.“ Die Figuren unterscheidet man in weibliche und männliche. Alle mit einem langen Zopf sind Frauen. „Diese hier mit dem hohen Hut ist sogar eine Königin“, berichtet mir der Handwerker, und Stolz schwingt in seiner Stimme mit.
Im Inneren des Inselkraters
In die nächste Bucht geht es anderntags früh am Morgen. Dort liegt Omoa, der Hauptort der Insel, ebenfalls im Inneren des großen Inselkraters. Die Fahrt führt an mehreren kleineren Vulkanen vorbei. Steilküste, Felsskulpturen und schmale grüne Täler bilden eine pittoreske Landschaft. Jedes Gehöft in Omoa hat seine eigenen Tikis aus Stein auf Zaunpfählen oder am Eingang stehen. Sie sollen Familie und Heim beschützen, Glück und Wohlstand bringen. Ein Bildhauer zeigt uns seine Werke. Er arbeitet mit Holz und Stein, nutzt aber auch Knochen oder Hörner von Rindern sowie lange Schwertfischdolche.
Kunstvoll kombiniert der große, kräftige Mann die Materialien. Ich spreche ihn auf seine Tätowierungen an. Stolz zeigt er mir die beiden miteinander verschlungenen Ringe auf seiner Brust. „Dieser symbolisiert mich und der andere meine Frau. Wir sind verbunden.“ Dann wandert der Finger an den Hals. Dort ziehen sich die Muster wie Halsketten über seine Schlüsselbeine. „Das sind meine Kinder, und dies Muster hier am Arm steht für meinen Vater“, erzählt er mit großem Ernst in Augen und Stimme. Polynesier verehren ihre Ahnen. Ähnlich den Göttern werden sie in aktuelle Entscheidungen und Rituale eingebunden.
Alle guten Dinge sind drei
Wir verlassen den Süden des Archipels und legen drei Stopps auf Tahuata ein, bevor es zu den nördlichen Marquesas geht. Unterwegs begleitet uns diesmal eine Gruppe Pilotwale. Unser Ziel ist Hapatoni. Der Ort liegt in einer weiten grünen Bucht. Die Brandung läuft im gleichmäßigen Rhythmus an den Steinstrand und entlädt sich in hohen Fontänen. Zum Glück gibt es hinter einer natürlichen Landzunge einen kleinen Hafen, in dem Fähren, private Boote, Wassertaxis und die Gendarmerie anlegen. Mit Heckanker liegt unser Dingi dort artig vor der Betonpier. Der Landgang lohnt sich.
Eine lange Uferpromenade aus festgetretener Erde und schwarzen Lavasteinen führt durch den Ort. Riesige alte Mandelbäume beugen sich übers Wasser. Das Meer hat einen Teil ihrer Wurzeln bereits freigespült und wird sich die Giganten wohl bald ganz holen. Uralte Fundamente und breite Terrassen aus schwarzem Basalt strukturieren den Hang. Die Dorfkirche ist ebenfalls aus den runden Felssteinen erbaut. Nebenan befindet sich der Friedhof.
Als Nächstes steuern wir den Hauptort der Insel an. In Lee der Felsen kommen wir gemächlich voran. Die Küste Tahuatas ist mit Höhlen übersät, eine reiht sich an die andere. Vaitahu liegt vor einer grünen Felswand und präsentiert sich voller Blütenstauden. Das Museum ist leider geschlossen, ein Supermarkt bietet das Notwendigste an, und bei „Chez Jimmi“ bekommen wir endlich eines der berühmten marquesischen Ziegengerichte serviert. Sie sollen die besten der Welt sein – was wir bestätigen können. Derart zartes Ziegenfleisch esse ich zum ersten Mal in meinem Leben.
Auf einem Spaziergang durch den Ort begegnen wir Teii, der uns auf sein Grundstück einlädt. „Ich habe Kürbis, Pampelmusen und Mangos für euch.“ Wir folgen dem dünnen, knittrigen Mann. Sein Grundstück ist groß, das Haus versteckt sich unter den Kronen alter Mangobäume. Teiis Mutter sitzt auf einer Bank und begrüßt uns fröhlich. Delphine ist 74 Jahre alt und zeigt stolz auf ihre Vanillepflanzen.
Ein grünes Netz über unseren Köpfen schützt die empfindlichen Gewächse vor zu viel Sonne. Teii zeigt uns die Blüten, umfasst sie vorsichtig, fast liebevoll, und öffnet mit einem zahnstocherähnlichen Zweig die winzige Kapsel, um den Pollen herauszuholen. Der weiße, klebrige Staub ist zwar kaum zu sehen, wird aber sofort zu einer anderen Blüte getragen, um sie zu befruchten.
„Warum machen das nicht die Bienen?“, frage ich verwundert. „Die kümmern sich um die Obstbäume, das hier können sie nicht“, erklärt uns Teii. Er deutet auf die vielen grünen Schoten an den Ranken. Die Arbeit lohne sich, er könne sie gut verkaufen. Mir hingegen wird zum ersten Mal bewusst, warum Vanille so teuer ist.
Grillabend am Strand
Ins drei Seemeilen entfernte Hanamoenoa müssen wir tags drauf motoren. In dieser nördlichsten Bucht von Tahuata bleiben wir ein paar Tage. Am Strand gibt es zwei Feuerstellen. Andere Segler haben bereits Grillroste, Eisentöpfe und Pfannen dort gelassen. Durch Palmen schauen wir am Lagerfeuer vorbei aufs Ankerfeld. Wir grillen Fisch und Würstchen, dazu gibt es Salate, Früchte, Wein und Bier. Solche Orte sind perfekt, um mit anderen Seglern zu klönen, Erfahrungen auszutauschen oder einfach gemeinsam den Moment zu genießen.
Das nächste Ziel, Ua Huka, ist weiter entfernt, 65 Seemeilen. Knapp zwölf Stunden benötigen wir dafür, dann erreichen wir unsere vierte Insel im Archipel. Die Bucht von Vaipaee ist schmal und lang. Sie erinnert an einen Minifjord. Wie durch einen Kanal, mit bis zu 70 Meter hohen Wänden rechts und links, passieren wir die enge Zufahrt. Die Dünung reflektiert mehrfach, sodass eine kabbelige Kreuzsee die Wasseroberfläche brodeln lässt. Durch die Löcher und Ritzen in den Ufersteinen fauchen meterhohe Fontänen.
Ua Huka besteht wie Fatu Hiva aus einer gebogenen halben Kraterwand. Die Südseite wurde vom Meer abgetragen. Im Inneren der einstigen Caldera ragt ein hoher roter Berg auf. In einem grünen Tal liegt der lang gezogene Hauptort. Wir müssen einige Kilometer wandern, um es zu durchqueren. Supermärkte, Rathaus und Post befinden sich direkt an der Hauptstraße. Die führt den Hang hinauf. Idyllische Grundstücke kuscheln sich tiefer im Tal zwischen den Kronen von Obstbäumen und Palmen. Wir entdecken ungewöhnlich viele Pferde, die hier frei herumlaufen.
Kraterwände erzählen Geschichte der Marquesas
So schön Ua Huka auch ist, die Ankerbedingungen sind eher bescheiden. Deshalb nehmen wir bald Kurs aufs 33 Seemeilen entfernte Nuku Hiva. Die Bucht von Taiohae ist groß, aber offen. Es steht Schwell. Zum Glück gibt es einen geschützten Kai, an dem wir mit dem Dingi zwischen Fischerbooten anlegen können. Direkt im Hafen wird Obst und sogar Gemüse verkauft. Nebenan ist ein Touristikbüro, wo man sich ein Auto mieten kann, um die Insel zu erkunden. Auch eine Post gibt es sowie gleich drei gut sortierte Supermärkte. Man könnte Taiohae als richtige Kleinstadt bezeichnen. Das Leben summt, die Hauptstraße wird von vielen Fahrzeugen frequentiert, und nicht wenige der Einwohner sprechen Englisch.
Ein Ausflug an die Nordküste lohnt sich aufgrund der spektakulären Felsformationen. Millionen Jahre alte, aus flüssiger Lava geformte Schlösser thronen mit etlichen Türmen auf dem Grad der Gebirgskette. Es sind die Reste erodierter Kraterwände. Schwarz und mächtig erzählen sie von der Geschichte dieser Inseln und geben einzigartige Fotomotive ab. Die Straße nach Norden führt mitten durch ein großflächiges Ausgrabungsgebiet. Archäologen klassifizieren Kamuhei als heilige Zeremonienstätte. Das Areal wurde in weiten Teilen freigelegt. Wir bestaunen die Überreste und auch die Größe dieser einstigen Siedlung.
Riesige Würgefeigen ziehen unseren Blick auf sich. Die größte war eine Begräbnisstätte. Schädel einstiger Opfer von zeremoniellem Kanibalismus, das heiligste Körperteil des Menschen, wurden in die Luftstützwurzeln gehängt, so erzählt man sich. Der mächtige Baum ragt eindrucksvoll etwa 80 Meter in die Höhe. Seine Luftwurzeln werden zu dünnen Stämmen, verschmelzen miteinander und bilden ein einzigartiges undurchdringliches hölzernes Geflecht von etwa 20 Meter Durchmesser.
Nächster Stopp: Daniels Bay
Die Daniels Bay erreichen wir mit einen Kreuzschlag. Sie liegt so tief in der Bucht, dass wir schließlich rundum von Felsen umgeben sind und uns beinahe auf einem See wähnen. Am Ende des linkerhand gelegenen Tals befindet sich der 350 Meter hohe Ahuii-Wasserfall. Die Wanderung dorthin führt an aufgegebenen Terrassen vorbei, auf denen nun Palmen, Bananenpflanzen, Mangobäume und Unkraut wuchern.
Offenbar war Hakaui früher einmal eine blühende Siedlung mit vielen Einwohnern. Ein kilometerlanger gepflasterter Weg in der Breite eines Ochsenkarrens führt bis zu einer Plattform, die einst für Zeremonien und Feste genutzt wurde.
Die südlich gelegene Nachbarinsel Ua Pou erreichen wir nach fünfstündiger Überfahrt. Der Hauptort Hakahau liegt an der Nordostküste. Auch hier sind die Felsen spektakulär. An der höchsten Spitze des alten Vulkankraters bleiben die Wolken hängen. Mit 1.232 Metern ist der Mont Oave die höchste Erhebung im ganzen Archipel.
Hakahau hat einen Wellenbrecher und damit einen recht ruhigen Hafen. Das Museum ist leider geschlossen, ebenso die Restaurants und eine Bäckerei. Wir haben einen Sonntagnachmittag erwischt. Am Strand grillen Einheimische, schauen ihren im Sand spielenden Kindern zu oder baden mit ihnen an der Betonrampe. Der lange Strand liegt fast ungenutzt in der Sonne. Nur ein paar Touristen sind im Wasser, um die Nachmittagshitze zu überstehen.
Tanz als Tradition auf den Marquesas
Ein paar Tage später legt morgens die „Aranui 5“ am Kai an und entlädt Waren und Touristen. Nun können wir sehen, wie viele Bewohner die Insel hat. Alles ist auf den Beinen. Man versammelt sich im Gemeindezentrum zu einem traditionellen marquesischen Tanz. Mit Blumenkränzen geschmückte Frauen stehen hinter langen Tischen und bieten Souvenirs an. Ihre farbenfrohen Kleider wetteifern mit Ketten aus roten Bohnen, perlmuttfarbenem Muschelschmuck und glänzenden Holzschnitzereien. Auf einer langen Tafel werden dicke grüne Blätter ausgelegt, auf ihnen verteilen Frauen eine Art Obstsalat.
Die Insulaner kommen nicht nur, um mit den Touristen Geld zu verdienen. Auch für sie ist es ein Festtag, an dem man sich schick anzieht, trifft, miteinander austauscht und sich des Lebens freut. Alles wartet auf den Höhepunkt der Veranstaltung. Es sind die Tänzer: tätowierte, halb nackte Männer mit Lendenschutz, Knochen um den Hals und Federn auf dem Kopf. Sie stellen indigene Krieger dar und präsentieren ihre Kraft und Kampfbereitschaft eindrucksvoll mit Haltung, Bewegung, Körperschmuck, Mimik und Gebrüll. Die hellen Stimmen der Frauen hingegen erinnern an die asiatische Herkunft dieses Volkes; sie werten das Kampfgeschrei der Männer deutlich auf.
Nach der Vorstellung frage ich einen der muskulösen Darsteller: „Tanzt du nur für die Touristen oder auch für dich selbst?“ Seine Antwort: „Ich tanze für den Chef dort oben, für Sonne und Mond, für Macron, die Touristen – und für mich. Ich liebe es!“
Wissenswertes über das Revier
Te Fenua Enata
Als „Erde der Männer“ wurde der Archipel einst von seinen Ureinwohnern bezeichnet. Er ist seit etwa 2.000 Jahren besiedelt; vermutlich von Westen aus kamen die ersten Menschen nach Hiva Oa. Erst ein spanischer Entdecker taufte die Inseln 1595 um in Marquesas. Heute gehören sie zu Französisch-Polynesien. Von den 14 Inseln vulkanischen Ursprungs sind sechs bewohnt. Höchste Erhebung mit 1.232 Metern ist der Mont Oave auf Ua Pou. Die Inseln haben fast keine Sandstrände und auch keine Saumriffe oder Lagunen, wie man sie anderswo in der Südsee findet. Sie sind stark zerklüftet mit tief einschneidenden Tälern. Im Luv der Gebirge überzieht tropischer Regenwald die Hänge, auf der Lee-Seite sind sie hingegen meist kahl. Die Ankerplätze befinden sich häufig in versunkenen Vulkankratern. Das Klima ist tropisch mit viel Regen und Lufttemperaturen von im Schnitt 28 Grad Celsius. Nachts kühlt es deutlich ab.
Tiki, Ahnherr der Menschen
Die Stein- oder Holzfiguren mit den überdimensionalen Köpfen und Augen stellen Götter und Geister dar, die Kraft, Schutz und Heilung bringen. Sie sind Teil der jahrtausendealten Kultur Polynesiens, die seit Ende des 20. Jahrhunderts wiederbelebt und teils auch neu kreiert wird. Auf den Marquesas gibt es Museen auf Tahuata (Vaitahu), Nuku Hiva (Hatiheu) und Ua Huka (Vaipaee).
Marquesanisch für Anfänger
- Mave mai – Willkommen
- Kaoha – Guten Tag
- Vaieinui – Danke
- Kaikai Meitai – Guten Appetit
- A Pae – Auf Wiedersehen
Auf fremdem Kiel durchs Archipel
Statt selbst hinzusegeln, kann man auf einer anderen Yacht anheuern. Viele Langfahrer benötigen Crew für die Pazifik-Passage – oder Geld. Manche Mitsegler steigen bereits in Panama oder auf den Galapagosinseln zu. Entsprechende Kojenangebote finden sich im Internet. Vor Ort kann man mit der „Aranui 5“ mitfahren. Die ist nicht nur Frachter und Fähre, sondern auch Kreuzfahrtschiff. Sie versorgt von Tahiti aus die Tuamotus und Marquesas. Dabei läuft das Schiff fast jede Insel an, nimmt zahlende Gäste mit, für die auch Landausflüge organisiert werden. Eine bessere Gelegenheit, die ansonsten geschlossenen Museen sowie lokale Tanzaufführungen und Kunsthandwerk zu sehen, gibt es kaum. Die Marquesas sind mit dem Flugzeug über Papeete/Tahiti erreichbar. Hiva Oa, Nuku Hiva und Ua Pou haben Flughäfen.

Die Autorin
Ricarda Wilhelm lebt mit ihrem Mann seit 2018 auf der Amel 54 „Lady Charlyette“. Ihre Reisegeschichten veröffentlicht sie digital und als Taschenbuch. In der YACHT berichtete sie zuletzt vom Vulkanausbruch auf La Palma sowie über die schönsten Buchten Martiniques. Ihren Bordalltag kann man mitverfolgen unter ricardawilhelm.wixsite.com/reise-mit-mir sowie auf Instagram (@reisemitricarda)