Neues Buch: So erlebte Boris Herrmann die ersten Tage der Vendée Globe 2024
YACHT-Redaktion
· 18.11.2025






Im Schnitt lege ich bei meiner Reise um die Welt jeden Tag die Strecke von Hamburg nach Mannheim zurück. Wer diese Fahrt mit dem Auto antritt, dem bieten sich unzählige Möglichkeiten, sich zu verfahren, falsch abzubiegen, in einer Baustelle festzuhängen. Wenn zwei Golfs gleichzeitig in Hamburg starten, kann es sein, dass sie durch unterschiedliche Bundesländer fahren und erst im Abstand von Stunden in Mannheim ankommen. Den Unterschied macht die Routenwahl. Entscheidend ist oft das Glück, ob man das Frankfurter Kreuz vor dem großen Unfall passiert oder danach.
Genauso funktionieren Hochseeregatten. Von außen betrachtet geht es bei einem Rennen auf dem Meer immer nur geradeaus. Tatsächlich aber bestimmen Windstärke, Windrichtung, Strömung sowie die Höhe, die Richtung und die Länge der Wellen unseren Kurs wie unsichtbare Straßen. Auch auf dem Wasser kann man sich hoffnungslos verfahren, Entwicklungen falsch einschätzen oder einfach Pech haben. Unser Stau ist die Flaute, unsere Überholspur das Foilen.
Das ist auch interessant:
Von dieser Überholspur war ich in den Stunden nach dem Start weit entfernt. Es war deprimierend zu sehen, wie Konkurrenten, die eben noch in Rufweite neben mir trieben, von einem Windhauch in eine bessere Position geschoben wurden. Es dauerte nicht lange, dann konnte ich sie nur noch auf dem Computerbildschirm sehen. Sie hatten eine grüne Welle erwischt, während ich in der falschen Spur festklebte.
Der erste Sonnenuntergang auf See, der Geruch des Meeres, die Dynamik dieses wunderbaren Bootes – das versetzt mich normalerweise in ein Hochgefühl. Diesmal nicht. Wenn man als Letzter hinter dem Feld hersegelt, hat man wenig Sinn für Schönheit. In der Nacht zum Dienstag bin ich, wie geplant, außen um das Sperrgebiet vor dem Kap Finisterre herumgesegelt. Jetzt endlich können wir, wie erhofft, unsere Vorteile bei Starkwind-Bedingungen ausspielen. Während wir entlang der Küste Portugals nach Süden brettern, kassieren wir ein Boot nach dem anderen. Am Mittwoch werden wir auf Platz fünf geführt.
Rock ’n’ Roll auf dem Atlantik
Nordatlantik, 12. November 2024
Ich bin jetzt den dritten Tag auf See und habe überhaupt noch nicht geschlafen. Mehr als Dösen habe ich mir nicht erlaubt, schließlich will ich den Rückstand aufholen. Wenn ich am Grinder kurble, merke ich deutlich, wie müde ich bin. Gleichzeitig spüre ich, wie die „Malizia-Seaexplorer“ und ich immer mehr eins werden. Mir wachsen Seebeine. Mein Körper weiß instinktiv, wo er hintreten muss. Auch bei ruppigem Wellengang bewege ich mich an Bord jetzt wieder genauso sicher wie in meiner Küche zu Hause.
Auf dem Weg nach Madeira bläst es mit 26 Knoten, manchmal auch mehr. Rock-’n’-Roll-Bedingungen. Wir hüpfen über die gewaltigen Wellen. Das Foil hebt den Bug drei, vier Meter hoch. Die Lage der „Malizia-Seaexplorer“ erinnert an ein startendes Flugzeug, dessen Bugrad schon in der Luft schwebt, während das hintere Fahrwerk noch über die Startbahn rollt. Vom Cockpit aus kann man die Wasseroberfläche erst in 300 Metern Entfernung sehen, alles davor bleibt im toten Winkel. Wir schweben in einer sicheren Balance über die Wellen. Ein erhabenes Gefühl. Ich versuche, den Moment aufzusaugen und auf meiner inneren Festplatte zu speichern.
Wenn ich an Land von der Faszination des Imoca-Segelns tagträume, dann sind es genau solche intensiven Momente, die ich auf meiner inneren Kinoleinwand abspiele. Nur sehr selten, wenn wir mit vollem Karacho eine große Welle hinunterjagen und sich der nächste Wellenberg steil vor dem Bug aufbaut, taucht das Boot in diese Wand aus Wasser ein. Das Vorschiff der „Malizia-Seaexplorer“ hat mehr Volumen, ihr Unterwasserschiff ist runder als das der anderen Yachten im Rennen. Das hat ihr den Spitznamen „SUV“ oder „Bus“ eingehandelt.
Mehr Rundungen für das Unterwasserschiff
Das Vorgängerschiff, mit dem ich bei der Vendée Globe 2020 gestartet bin, war schmaler, hatte einen spitzeren Bug und ein flaches Unterwasserschiff. Die „Malizia“ ist damals immer wieder so brutal in die Wellen gestochen, dass mir angst und bange wurde. Deshalb habe ich beim nächsten Boot nach einer Lösung gesucht, um die Schläge abzumildern. Ein dickerer Bug hat mehr Auftrieb und taucht nicht so tief ein. Gleichzeitig drückt die Rundung im Unterwasserschiff das Vorschiff schneller wieder an die Oberfläche.
Es geht bei dieser Konstruktion also nicht um den Topspeed. Womöglich sind die schmaleren Imocas sogar einen Tick schneller. Aber wir krachen nicht so oft in die Wellen, und wenn es doch mal passiert, werden wir dabei nicht so brutal abgebremst. Wer seltener bremst, ist am Ende schneller.
So wie beim Ocean Race 2022. Während der Königsetappe in den südlichen Ozeanen herrschten an vielen Tagen perfekte Bedingungen für dieses Bootsdesign: Stetiger Wind über zwanzig Knoten von raumschots, also von schräg hinten, trieb riesige, lange Wellen vor sich her. Die „Malizia-Seaexplorer“ gewann die Etappe, obwohl wir wegen einer Reparatur am Mast fast 500 Seemeilen Rückstand aufholen mussten.
Der erhoffte Geschwindigkeitsvorteil war aber nicht der Hauptgrund für mein Konstruktionsexperiment. Mir waren vor allem Stabilität und Sicherheit wichtig. Wenn eine acht Tonnen schwere Yacht von 75 Stundenkilometern auf unter 20 abgebremst wird, treten gewaltige Kräfte auf, vor allem im Rigg. Die Segel drücken mit einer Leistung von bis zu 3.000 PS den Mast nach vorne, während die Wellen das Schiff mit brachialer Gewalt abbremsen. Mit mehr Volumen im Bug und einem runderen Unterwasserschiff lässt sich die Zahl der Schockbelastungen verringern und ihre Intensität abmildern. Das schont das Material.
Der Rumpf und die wichtigsten Strukturteile der „Malizia-Seaexplorer“ bestehen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Der ist leicht und stabil zugleich. Trotzdem sind die Rennyachten enormen Kräften ausgesetzt. Genau wie wir Segler. Die Schale meines Cockpitsessels aus Carbon ist auf einem Stoßdämpfer installiert, der die härtesten Schläge abfedert. Alle paar Sekunden schießt ein Wasserstrahl gegen die massiven Kajütfenster. Man fühlt sich wie im Inneren einer Waschmaschine. Ohne Kopfhörer ist der Lärm nicht auszuhalten.
Hochseesegeln ist Indoorsport
Trotzdem ist die Kajüte in meinem SUV ein vergleichsweise wohnliches Zuhause, das in den kommenden Wochen fast durchweg mein Aufenthaltsort bleiben wird. An Deck zu sonnen, ein Buch zu lesen oder mit einem Cappuccino in der Hand gegen den Mast gelehnt in die unendliche Ferne zu schauen, dazu wird es nur selten Gelegenheit geben. Mit solch romantischen Vorstellungen des Segelns auf dem Ozean hat die Realität beim härtesten Rennen der Welt für meinen Geschmack viel zu wenig gemein. Wir befinden uns meist viele Hundert Meilen entfernt vom nächsten Gebäude.
Trotzdem ist Hochseesegeln streng genommen ein Indoorsport. Bei den früheren Imoca-Generationen war das Cockpit in der Regel zum Heck hin weitgehend offen, wie eine Garage mit offenem Tor. Nur eine Wand aus Segeltuch schützte notdürftig vor der Kälte. Bei den neusten Konstruktionen ist das Cockpit in die Kajüte integriert und komplett geschlossen. Es ist eine rundum stabile Trockenzelle. Alle Fallen, alle Schoten, alle Strecker werden in die Kajüte umgelenkt und hier mit einem Coffee-Grinder bedient.
Die Welt da draußen nehme ich vor allem über die Bilder wahr, die von den vier Außenkameras eingefangen werden. Nur zum Segelwechseln oder zu den regelmäßigen Kontrollgängen ziehe ich den Reißverschluss zum Kajüteingang auf und verlasse den wärmsten Ort, den es im November auf dem Nordatlantik gibt. Gesteuert wird die „Malizia-Seaexplorer“ zu 99 Prozent der Zeit nicht von mir, sondern von einer hochkomplexen Selbststeueranlage. Bestenfalls zwei Stunden könnte ich das Boot genauso schnell segeln wie der Computer, dann würde meine Konzentration nachlassen. Die des Computers nicht.
Über WhatsApp erfahre ich, dass Nicolas Lunven den 24-Stunden-Rekord für Monohulls gebrochen hat. Bislang hat die „Malizia-Seaexplorer“ diese Bestmarke gehalten. Beim Ocean Race 2022 haben wir den Rekord herausgesegelt. Als unsere Leistung vom Race-Committee bestätigt wurde, feierten wir ausgelassen an Bord. Dieses Glücksgefühl gehört zu meinen schönsten Segelerlebnissen. Damals war Nico noch Teil der „Malizia“-Crew und mit an Bord. Ich freue mich für ihn und schicke ihm einen Glückwunsch per WhatsApp. Rein sportlich gesehen ist sein Rekord vielleicht sogar noch wertvoller als unserer, weil er ihn allein herausgesegelt hat. Aber allein zu feiern macht keinen großen Spaß. Nico ist nicht nur ein toller Segler, sondern vor allem genial bei der Routenwahl. Sagenhafte 546,60 nautische Meilen oder 1.012,30 Kilometer hat er mit seiner Holcim-PRB in 24 Stunden abgeritten.
Ein ungewöhnliches Windloch
Nordatlantik, 15. November 2024
Auf dem Bildschirm vor mir kann ich sehen, dass mein Speed immer wieder die Marke von dreißig Knoten überspringt. Die Yacht läuft großartig, die Anzeige auf dem Bildschirm wechselt zwischen grün und gelb. Das heißt, dass ich schneller oder gleich schnell bin wie die Führenden. Als das Feld heute die Kanarischen Inseln an Backbord liegen lässt, habe ich mich auf Platz drei nach vorne gekämpft.
Wenn ich nach einem Kurzschlaf aus der Koje krieche, muss ich jetzt kein dickes Ölzeug mehr anziehen. In den nächsten zwei Wochen werde ich es nicht brauchen. Endlich Sonne, endlich Wärme. In der Spitzengruppe zu segeln ist ein schönes Gefühl. Dieser Gesellschaft fühle ich mich zugehörig.
Die gute Position ist leider nur ein psychologischer Vorteil. Ich fürchte, das kann sich schnell wieder ändern, denn vor dem Feld liegt ein ausgedehntes Schwachwindgebiet. Die führenden Boote werden es früher erreichen und darin festhängen, während die hinteren mit dem guten „alten“ Wind heranrauschen.
Das Feld schiebt sich zusammen. Es ist dieselbe Situation wie bei einer Regatta auf dem Baggersee. Lage und Ausdehnung des Flautenlochs sind ungewöhnlich. Wir befinden uns auf der Höhe von Westafrika. Eigentlich sollte hier bald der Nordostpassat beginnen und uns mit Macht über den Atlantik treiben. Es ist eines der zuverlässigsten Windsysteme auf dem Ozean, das seit Kolumbus zur Überquerung des Atlantiks von Ost nach West genutzt wird. Doch irgendjemand scheint den Wind abgeschaltet zu haben.
Gerade habe ich ein Video gestreamt, in dem der Ire Marcus Hutchinson interviewt wurde, einer der profundesten Kenner der Vendée Globe. „Wir haben noch nie ein so großes Windloch im Nordatlantik gesehen, das so lange andauert“, erklärt Hutchinson. Ob das nur eine zufällige Abnormität des Wetters ist oder schon ein Anzeichen für den Klimawandel, lässt sich erst beantworten, wenn solche Unterbrechungen im Passat künftig häufiger vorkommen. Und dafür braucht man entsprechende Daten.
Nach einer Woche auf See hole ich eine Drifter-Boje aus der Kajüte, um sie an der vereinbarten Position ins Meer zu werfen. Sie soll vor allem den atmosphärischen Druck messen, der für Wettervorhersagen ebenso notwendig ist wie für die Langzeitbeobachtungen der Veränderungen des Klimas. Das Hightechgerät übermittelt also Messwerte, die wir Segler für unsere Routenwahl brauchen. Satelliten liefern nur optische Daten über Wolken, Niederschlag, Wind, Wellen und inzwischen auch über die Veränderungen der Planktonvegetation. Den Luftdruck messen sie nicht. Diese Angaben sind für ein vollständiges Bild aber unverzichtbar.
An Land gibt es unzählige Messstationen. Auf dem Ozean braucht man diese speziellen Bojen. Aktuell schwimmen weltweit etwa 1.400 Drifter in den Weltmeeren, 230 davon im Nordatlantik. Inzwischen bin ich nicht mehr der einzige Teilnehmer der Vendée Globe, der so eine 22-Kilo-Boje an Bord mitschleppt. Diesmal werden sieben weitere Drifter-Bojen von meinen Konkurrenten an Stellen ausgesetzt, die Wissenschaftler zuvor bestimmt haben.
Die gesammelten Daten werden an die World Meteorological Organization (WMO) gesendet. Die Batterien der Messbojen halten bis zu vier Jahre, sie werden also bis zur nächsten Vendée Globe ihren Dienst für die Wissenschaft verrichten. Die meisten werden irgendwann ans Ufer gespült, an die WMO zurückgeschickt, aufgearbeitet und gehen dann wieder an den Start.
Bevor ich die Boje übers Heck ins Kielwasser werfe, kritzele ich mit Edding eine Botschaft darauf: „There is no Planet B – Malizia – Climate Action Now“. Vielleicht findet sie ja jemand und schickt uns eine Nachricht.
Das Buch: “Die Welt unter meinem Boot”
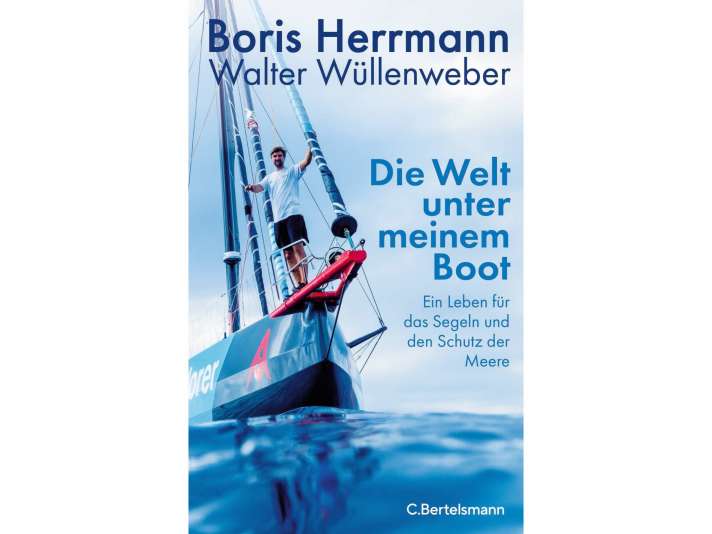
Gemeinsam mit Co-Autor Walter Wüllenweber beschreibt Profi-Segler Boris Herrmann in seinem Buch „Die Welt unter meinem Boot“, wie er seine beiden Professionen für sich entdeckte und wie sie seither sein Leben bestimmen. Erstmals gibt er Einblicke in ein faszinierendes Projekt, an dem er in enger Zusammenarbeit mit Meeresforschungsinstituten arbeitet.

