



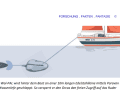
Gegründet hat die Firma der Heikendorfer Meeresbiologe-Professor Dr. Boris Culik, der lange für das Forschungsinstitut Geomar in Kiel gearbeitet hat. Er beschäftigte sich mit dem Problem der Schweinswale in der Ostsee. “Sie verfangen sich immer wieder in den Stellnetzen der Fischer und verenden”, so Culik. Um das zu verhindern, entwickelte er einen aktiven Pinger, der den Tieren ein Warnsignal sendet: “Im Prinzip warnt der Pinger die Tiere in ihren Lauten ‘Hau ab’, es droht hier eine Gefahr.” Diese Entwicklung ist heute ein nachgewiesener, funktionierender Standard und wird an der deutschen Ostseeküste bereits seit Jahren in der Fischerei eingesetzt, um den Beifang von Schweinswalen zu verringern. Die Erfolgsquote liegt bei 80 Prozent, und die Geräte werden jedem Fischer in Schleswig-Holstein vom Ostsee-Infocenter in Eckernförde kostenlos angeboten.
Die Idee entstand beim Schweinswal-Schutz
Im Zuge dieser Entwicklung kamen Segler auf den Norddeutschen zu. “Die berichteten mir von den Problemen mit den Orcas vor Portugal und Spanien, so begann ich mich mit dem Problem 2021 auseinanderzusetzen.” Das war komplex, denn jede Spezies benutzt ihre eigene “Sprache” auf einer eigenen Frequenz . “Es ist sogar so, dass die Ostsee-Schweinswale sozusagen ihren eigenen ‘Dialekt’ sprechen”, die Stellnetz-Pinger für die Nordsee mussten entsprechend angepasst werden. Genau dasselbe war für ein ähnliches Gerät mit den Orcas nötig.
“Wir mussten erst die richtige Frequenz und Laute im Ultraschall-Bereich finden, die sozusagen in der Sprache der Orcas eine Warnung sind, die sie dazu bringt, fernzubleiben”, so Culik. Da es aber Forschung zu Orcas und Netz-Vergrämern in Skandinavien gab, wurde Culik fündig. Als die gefunden waren, stellte sich die nächste Frage: Wie stattet man ein Schiff mit genau dieser Technik aus? Zunächst überlegte er eine fest verbaute Lösung am Ruderblatt, die aber nicht praktikabel war. Die Segler waren eher an einer flexiblen Lösung interessiert, da es weltweit nicht viele Gebiete gibt, in denen Orcas Yachten attackieren.
Der Orca-Pinger ist simpel, handlich und erschwinglich
So entstand der Entwurf des Wal-Pal: Es handelt sich um eine torpedoförmige, 20 Zentimeter lange und sechs Zentimeter dicke Sendeeinheit mit Elektronik und Akku, die den eigentlichen Laut ausstrahlt. Die wird an einem zehn Meter langen Drahtseil mit einem Scherbrett ins Heckwasser der Yacht gelassen. Ist die Yacht nun in Fahrt, sendet der Wal-Pal ein Signal nach vorn in Richtung Ruderblatt. “Das Signal reicht etwa 200 Meter weit nach vorn und zu den Seiten etwa 100 Meter weit, belästigt also nicht Tiere, die weiter weg sind”, so Professor Boris Culik.
Mittlerweile gibt es dazu auch technische EU-Standards, die das Gerät selbstverständlich einhalte. Wichtig sei, dass die Yacht in Fahrt bleibe, damit der Wal-Pal nicht nach unten hängt, dann sendet er das Signal nach unten. “Wir hatten eine Crew, die bei Sichtung der Wale die Fahrt aus dem Schiff nahm. Daraufhin hing die Einheit in zehn Meter Tiefe senkrecht nach unten und strahlte das Signal nicht mehr zum Ruder, und die Tiere beschädigten es.”
Mittlerweile hat Culik fast 200 der Geräte, die 498 Euro kosten, verkauft und erste Feedbacks, er arbeitet in einem Projekt auch mit Trans-Ocean zusammen. “Ich bitte alle Käufer, mir ihre Erfahrungen zu schildern. Leider haben das bislang nur elf Prozent getan.”
“Die Anzahl der Rückmeldungen der angeschriebenen Kunden war mit insgesamt nur 19 leider geringer als erhofft. Wir gehen davon aus, dass die Segler, die sich nicht gemeldet haben, dazu auch keinen Anlass hatten, weil keine Sichtung oder Schäden aufgetreten waren. Das ist natürlich nur eine Annahme. Andererseits haben beide Segler, die bislang einen Schaden erlitten, sich unverzüglich bei uns gemeldet und bitter beschwert. Diese Zahl ist also als sehr zuverlässig einzuordnen. Insgesamt berichten sechs Segler von Interaktionen, von denen vier ohne Schäden abliefen (67 %). 13 Segler hatten keine Sichtungen”, so Culik.
Erste Erfahrungen machen große Hoffnung
Diese Zahlen seien natürlich nur vorläufig, denn die Datenlage ist aufgrund der geringen Anzahl an Erfahrungsberichten noch sehr dünn. Wenn der Unterschied zwischen 11 % Schäden (allgemein) und nur 1 % (bei Einsatz des Wal-Pal) sich in Zukunft bestätigt, würde der Wal-Pal die Schadenswahrscheinlichkeit um 90 % verringern.
Auf der Webpage des Herstellers sind die Erfahrungsberichte der Kunden und alle weiteren technischen Daten zu finden. Die Sendeeinheit ist mit einem Lithium-Ionen-Akku bestückt, der für etwa eineinhalb Jahre Dauerbetrieb reicht, bei entsprechend geringerer Nutzung nur bei der Passage der betroffenen Seegebiete entsprechend länger.
“Wichtig sind auch die Wetterbedingungen, in denen das Gerät benutzt wird”, so Culik. “Ist es windig, es herrscht hoher Seegang und die Yacht erzeugt in der See selbst immer mehr Geräusche durch Bugwelle und Bewegungen, schluckt das einen Teil des Schalls des Pingers.” Dann kann die Wirkweite sinken. Ideal ist zudem eine Bootsgeschwindigkeit von nicht mehr als sechs bis sieben Knoten, da der Wal-Pal sonst zu dicht an der Oberfläche geschleppt wird. Darüber sei es sinnvoll, bei einer Sichtung den Speed zu reduzieren.
Es könnte also sein, dass erstmals seit Beginn der Orca-Probleme vor etwa drei Jahren der Seglerwelt eine Lösung des Problems angeboten wird, die technisch nicht zu teuer und kompliziert ist. Und das sind gute Nachrichten für alle Crews, die entweder ins Mittelmeer überführen oder auf die Kanaren wollen, etwa um transatlantik zu segeln.

